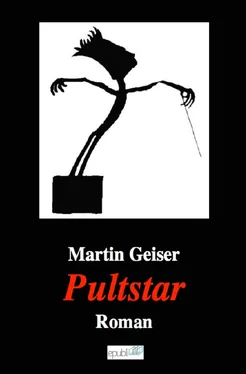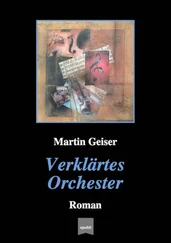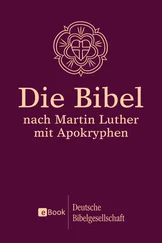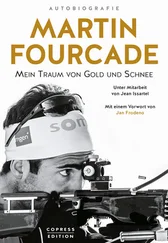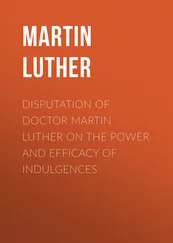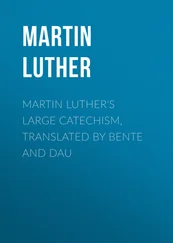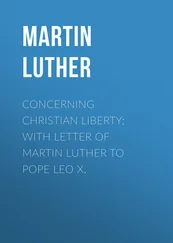Damit machte er es mir enorm schwierig. Er setzte sich auf einen Stuhl neben dem Flügel und lehnte sich zurück. Ich sah ihn nicht an, wusste aber, dass er jetzt die Augen geschlossen und die rechte Hand leicht erhoben hatte, bereit zum Mitdirigieren.
Ich beugte mich vor und begann mit dem ersten Klaviereinsatz. Ruhevoll, gleichmäßig schreitend, sehr ausdrucksvoll, darauf bemüht, die vom Orchester vorgegebenen Klangfarben weiterzutragen und voll zum Ausdruck zu bringen.
Ich bemerkte, dass Vater die Hand gesenkt hatte und nicht mehr mitdirigierte. Da brach ich ab und blickte ihn an. Er saß aufrecht da, die Arme verschränkt und die Lippen fest zusammen gepresst.
Er blickte mir direkt in die Augen und sagte dann: »Das war wunderschön, mein Junge.«
Ich wusste nicht, wann er mich das letzte Mal so genannt hatte. Auf jeden Fall lief es mir eiskalt den Rücken runter. Zugleich fühlte ich mich aber völlig hilflos, da ich mit seiner Bemerkung nichts anzufangen wusste.
Er holte tief Luft, beugte sich vor zu mir und wiederholte noch einmal: »Das war wunderschön, aber es war nicht Brahms.«
Ich blickte ihn erstaunt an.
»Es war alles, was die Romantik ausmacht«, fuhr er fort. »Es war ausdrucksvoll, molto espressivo , mit großer Sensibilität vorgetragen. Ich konnte beinahe den Flügel weinen hören.«
Ungläubig schüttelte ich den Kopf. Ich verstand nicht, was er denn aufgrund seiner Beschreibung an meinem Spiel auszusetzen hatte.
Dann meinte er: »Bitte, lass mich mal an den Flügel. Ich möchte dir zeigen, was ich meine.«
Ich erhob mich und stellte mich hinter ihn. Er ließ sich seufzend auf den Klavierstuhl nieder und blieb wie versteinert sitzen. Dann hob er den Zeigfinger und ließ ihn ganz leicht kreisen. Seine Lippen waren leicht gespitzt, und er blickte zur Decke. Er drehte sich gegen mich und suchte meinen Blick.
»Hörst du das Orchester?«, fragte er. »Du musst zuerst das Orchester hören: das herrliche fallende Thema des Fagotts, welches diesen Satz mit einer Melodie beginnt, die danach von den Streichern weitergetragen wird. Hörst du’s?«
Er blickte mich fragend an. Wahrscheinlich fand er in meinem Gesicht nicht die Bestätigung, die er sich gewünscht hatte, denn er lächelte milde und schüttelte den Kopf. Dann griff er nach meiner Hand und zwang mich sanft, neben ihm auf dem Klavierstuhl Platz zu nehmen.
»Schau, wir müssen uns zuerst die Orchestereinleitung anschauen. Ich habe sie dir vorher vorgespielt. Aber da gibt es noch mehr darüber zu sagen, noch viel mehr. Hör gut zu!«
Und dann spielte er den Orchesterpart nochmals, sang dazu einzelne Stimmen mit, brach ab, wiederholte und wechselte die Stimmen, sang einmal die Celli, dann die Flöte, stellte das Ganze nach und nach zusammen, erklärte, analysierte, ohne Hast, geduldig, aber eindringlich, und mit einer Logik, die mir den Mund offenstehen ließ. Diesen Orchesterteil, der lediglich etwa zwei Minuten dauert, hatte er mir nach einer Stunde fertig erklärt und dargelegt. Die Kälte, die ich zu Beginn empfunden hatte, war verschwunden und hatte Raum für eine einleuchtende und unabdingbare Musik geschaffen. Er strahlte mich an, da er merkte, dass wir gleich fühlten und dass ich seine Welt verstanden hatte. Dann erhob er sich und sagte:
»Und jetzt dein Klaviereinsatz. Kein Angst, er wird perfekt klingen.«
Ich setzte mich an den Flügel und ließ mir die Einleitung nochmals durch den Kopf gehen. Er stand daneben, eine Hand auf den Flügel gelegt, mir den Rücken zugewandt, und ich wusste, auch wenn ich sein Gesicht nicht sehen konnte, dass er in diesem Moment das Gleiche wie ich fühlte. Wir hörten es in uns. Wir waren eins.
Ich ließ den Kopf leicht nach vorne fallen, hob die Hände, berührte die Tasten und begann.
Als ich geendet hatte, blieb ich sitzen, starrte die Steinway -Aufschrift vor mir an und kam langsam wieder in die Welt jenseits der Musik zurück. Ich suchte Vaters Blick, er schaute mir in die Augen. Es brauchte keine Worte, wir hatten es erlebt , und es war richtig so.
Das war mein Vater.
Ich glaube, das war einer der wenigen Momente gewesen, in dem ich mir seinen aufrichtigen und uneingeschränkten Respekt verdient hatte. Ich wünschte, wir hätten uns noch häufig so blind verstehen können.
Niemand würde je wieder den grauenvollen Aufschrei zu Beginn des letzten Satzes von Sibelius’ Erster mehr hören. Vater hatte diese Symphonie zu einem seiner wenigen Schlüsselwerke außerhalb der deutsch-österreichischen Musikliteratur gemacht, das er häufig aufs Programm setzte. »Eine Aufführung von Sibelius’ E-Moll-Symphonie mit Victor Steinmann ist ein Erlebnis, ein Ereignis; wer immer ihm auch beigewohnt haben mag, er wird es nie mehr aus seiner Erinnerung bringen; dem Maestro gelingt es, eine Tragik ohnegleichen aufzutürmen, die im letzten Satz kumuliert und den ganzen Weltschmerz unverhohlen und mit einer eruptiven Kraft zum Ausdruck bringt«, hatte irgendein Kritiker in irgendeiner sich für wertvoll und aussagekräftig haltenden Musikzeitschrift zum Besten gegeben. Jedes Wort habe ich mir gemerkt.
Ich erinnere mich, wie ich zum ersten Mal Vater mit diesem Werk auf der Bühne erlebt habe: Es war in einer Probe, und ich durfte als kleiner Bub von sechs oder sieben Jahren im Parterre anwesend sein.
Ich saß also in einem Sessel, die Beine, die noch nicht bis zum Boden reichten, baumelten in der Luft, und ich hatte ein Comicheftchen vor mir auf den Knien, das ich aber bereits von vorne nach hinten und von hinten nach vorne ausgiebig studiert hatte und langweilte mich dementsprechend, da mich das, was vorne auf dem Podest geboten wurde, nicht wirklich interessierte. Ich war noch zu klein. Manchmal blickte ich auf, besonders wenn Vater eine harsche Anweisung gab.
»Kann ich die Oboe noch einmal hören, oder haben Sie sie etwa gehört?«
»Meine Herren, Vibrato zu spielen ist keine Kunst, sondern ein Handwerk, also versuchen Sie doch bitte nicht, kunstvoll zu wirken.«
»Bässe! Mein Gott! Haben Sie etwa Minderwertigkeitskomplexe? Ihr Ding ist doch groß genug oder etwa nicht?«
So etwa könnte es geklungen haben, so habe ich Vater oft erlebt. Mit einem verklärten Lächeln lasse ich mir solche Anweisungen wieder durch den Kopf gehen.
Damals war niemandem zum Lachen zumute gewesen, weder mir noch den Musikern – und dann kam dieser letzte Satz von Sibelius’ erster Symphonie. Forte-Einsatz der Violinen, gefolgt vom Blech.
Ich blickte auf, doch wohl mehr aus Langeweile, weil Micky Maus und Donald Duck beim x-ten Male wirklich nicht mehr interessant waren und registrierte, wie Vater den Stock senkte, nach unten auf seine Schuhspitzen starrte und den Kopf schüttelte. Er war aufgestanden, um diesen Einsatz zu geben – sonst probte er eigentlich meistens sitzend – und setzte sich jetzt wieder auf seinen Stuhl, den Kopf immer noch gesenkt.
Es war mucksmäuschenstill im Orchester, und ich sank in meinen Stuhl zurück, den nächsten Wutausbruch meines Vaters erwartend. Doch er blieb still. Wie hypnotisiert starrte ich auf Vater, der seinen Kopf langsam hob und ins Orchester blickte. Sein Blick war verändert, ich wusste nicht, ob er ins Leere starrte oder ob er einen bestimmten Musiker fixierte. Da hob sich sein Kopf noch ein wenig, und ich stellte fest, dass er jetzt einen Blick in die Runde warf, wahrscheinlich jeden Musiker von kurz anblickend, die Augen dämonisch flackernd, nicht von dieser Welt. Es war nach wie vor kein Pieps zu hören, wie gebannt studierte ich Vaters Gesicht und merkte, dass er seine Lippen nun leicht gespitzt hatte und den Mund kaum bemerkbar öffnete.
Er blieb sitzen und hob erneut seinen Taktstock. In Sekundenschnelle machten sich die Musiker bereit. Mit einer leichten Aufwärtsbewegung gab er den Einsatz. Es war fast nur das Zucken in seinem Handgelenk zu beobachten gewesen. Ein Nichts für einen Forte-Einsatz.
Читать дальше