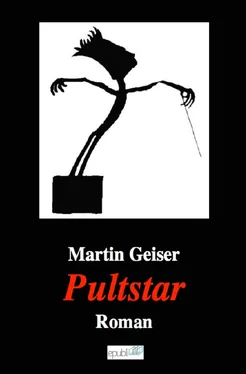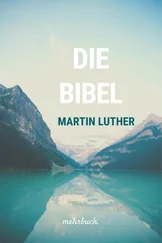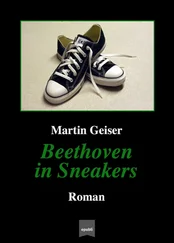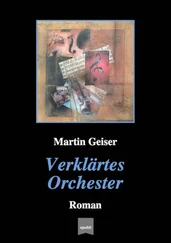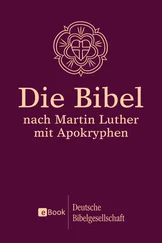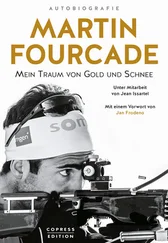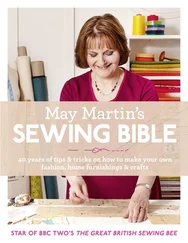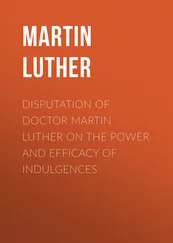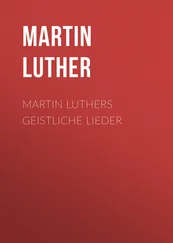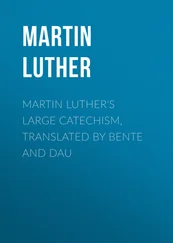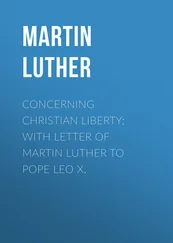Der Konzertmeister dreht sich nach hinten und informiert die ersten Violinen, die anderen Musiker stehen in großer Erregung auf, um endlich auch zu erfahren, ob jetzt gespielt werden kann oder nicht – Ist der alte Tyrann etwa einer Herzattacke erlegen? –, und der Lärmpegel nimmt bedenkliche Frequenzen an.
Dann dreht sich der Intendant gegen das Publikum und gibt irgendeine harmlose Version der Tatsachen bekannt – Es darf ja keine Panik ausbrechen –, vielleicht etwas wie: Dem Maestro ist gar nicht gut oder: Es hat einen bedauernswerten Zwischenfall gegeben oder was auch immer, aber auf jedem Fall mit der finalen Konsequenz, dass Sibelius’ Erste nicht gespielt werde, dass das Konzert damit beendet sei und dass kein Anspruch auf Rückvergütung der Eintrittskosten erhoben werden könne und so weiter und so fort.
Die Vorstellung kostet mich tatsächlich ein Lächeln.
In der Garderobe trifft mittlerweile der Notarzt ein, während das Publikum den Saal verlässt, kopfschüttelnd, ungläubig, Voten wie »Das ist doch eine Frechheit« und »So etwas habe ich ja noch nie erlebt« von sich gebend, da sie ja über die wahren Ereignisse nicht informiert worden sind. Es ist in den letzten Jahren nämlich häufig vorgekommen, dass Vater einen Auftritt kurzfristig und ohne große Erklärung einfach sausen lässt.
Niemand im Saal weiß zu diesem Zeitpunkt, dass sie die letzten Menschen gewesen sind, die Victor Steinmann musizieren gehört haben, ja, dass die Coda des Prokofjew-Violinkonzertes der letzte musikalische Akt meines Vaters gewesen ist.
Wenn ich so darüber nachdenke: Ich hätte es natürlich auch noch melodramatischer machen können.
Vaters Frack anziehen, das Ende der Pause abwarten, und dann – als ob nichts gewesen wäre – aufs Podest laufen und mich vors Orchester stellen, verwunderte und ungläubige Blicke auf mich ziehend. Dem Konzertmeister gönnerisch zunicken, den Taktstock heben und den Einsatz geben, damit die Unruhe im Publikum zum Schweigen bringen.
Meine Gedanken schlagen Purzelbäume.
Und dann hätte vielleicht auch noch ein anderes Werk auf dem Programm stehen sollen. Man stelle sich vor: Hector Berlioz’ Symphonie fantastique! Nach den letzten Klängen des Hexensabbats würde ich mich umdrehen, der Applaus setzt gerade ein, und dann die Pistole hervornehmen und mir eine Kugel in den Kopf schießen.
Großartig! Das wär’s doch gewesen!
Aber das hebe ich mir für später auf.
Denn nun sitze ich hier in La Croix Valmer, in unserem wunderschönen Ferienhaus am Plage de Gigaro an der Côte d’Azur und lächle, während ich mir meine todernsten Fantasien durch den Kopf gehen lasse.
Ich blicke wieder zum Fenster hinaus, lehne mich in meinen Stuhl zurück und lasse meinen Blick durchs Zimmer schweifen. Meine Augen schmerzen von der flackernden Helligkeit des Bildschirms, doch noch gönne ich mir keine Ruhe. Mein Blick fällt auf eine zusammengefaltete Seite einer Zeitung, die in der Ablage auf dem Schreibtisch liegt und die Vater wohl von einer Konzertreise mit nach Hause genommen hat. Es handelt sich um das herausgerissene Feuilleton des Boston Globe, und ich entdecke darin einen Artikel, unter dem ein Bild von Vater abgedruckt ist.
Merkwürdig, gewöhnlich scherte er sich keinen Deut um die Meinung der Musikkritiker. Es musste sich also um einen äußerst positiv verfassten Artikel handeln, der auf seine starke Zustimmung gestoßen war, sonst hätte er ihn nicht aufbewahrt.
Ich greife nach der Seite und beginne zu lesen:
»Nie zuvor habe ich Brahms so musiziert gehört. Victor Steinmann ist es gelungen, seiner Zuhörerschaft einen Brahms zu präsentieren, der noch für sehr viel Gesprächsstoff sorgen wird und der uns den immer wieder falsch schubladisierten Romantiker in einem neuen Licht sehen lässt.«
Ich ziehe die Augenbrauen hoch, blicke von der Zeitung auf und erinnere mich: Vater ist anfangs dieses Jahres in den Vereinigten Staaten unterwegs gewesen, wo er mit einem amerikanischen Orchester in verschiedenen Städten einen Brahms-Zyklus zum Besten gegeben hat.
Der Musikkritiker der vor mir liegenden Zeitung ist ein großer Bewunderer von Vaters Arbeit. Er ist mir bestens bekannt und hat vor Jahren einen grässlichen Verriss über mich verfasst. Ich schlage die Augen nieder und starre erneut auf den Titel des Artikels.
Entromantisierter Brahms .
Ich schlucke leer und lese weiter:
»Maestro Steinmann verstand es, das Publikum mit viel Feingefühl und absoluter Transparenz durch die Partitur zu führen. Er vermied jeden Anflug von Sentimentalität und war fest gewillt, dem Auditorium zu zeigen, wo Brahms seiner Meinung nach hingehört – nämlich in die Sparte der Klassik. Es war unglaublich, mit anhören zu dürfen, wie Steinmann mit dem Orchester vom ersten Ton an in eine ganz andere Welt eintauchte, als wir es uns bisher von einem Brahmswerk gewöhnt waren. Zuweilen spröde, oft hart und absolut strikt dem klassischen Ton untergeordnet. Das Orchester folgte dem Maestro auf beinahe wundersame Weise und setzte zu einer Leistung an, wie wir sie schon lange nicht mehr von dieser Formation hören durften.«
Wieder blicke ich auf und starre ins Leere. Nun habe ich Klarheit über den Grund, weshalb der Artikel aufbewahrt worden ist.
Entromantisierter Brahms – genau, was Vater immer vorgeschwebt hat. Ich erinnere mich gut an seine Wutausbrüche, wenn er etwas über den Romantiker Brahms gelesen oder gehört hat.
»Alles Dilettanten!«, tobte er in solchen Augenblicken. »Jedes Kind weiß doch, dass Brahms nichts mit Romantik zu tun hat. Jeder, der eine Partitur lesen und Strukturen erfassen kann, muss doch den Klassiker in diesem Komponisten erkennen. Die Architektur, die Strenge, die Ökonomie, der Aufbau, mein Gott, was soll das mit Romantik zu tun haben? Und dann vor allem der Ton, der vorherrscht. Man kann doch nicht so verbohrt sein und ihn nur aufgrund seiner Lebensdaten einer Epoche zuschreiben, mit der er nur am Rande etwas zu tun hat!«
Ich war jeweils nicht gewillt, auf solche Wutausbrüche zu reagieren, auch wenn ich mit ihm nicht einer Meinung war. Meine Argumente hätten auf keine Art und Weise ausgereicht, um ihn auch nur ansatzweise in die Schranken weisen zu können. Zu überlegen war sein Fachwissen, zu mächtig seine Persönlichkeit und zu raffiniert seine Rhetorik.
Scheinbar hatte er es während seiner USA-Tournee also wieder einmal geschafft, das Publikum, oder zumindest die Kritiker, von seinen Ansichten, was Brahms betrifft, zu überzeugen.
Keiner kann ihn wohl besser verstehen als ich.
Ich erinnere mich, etwa zwanzig Jahre ist es wohl her, an die Vorbereitungen zu einem Auftritt, einem unserer letzten gemeinsamen, an dem Brahms‘ erstes Klavierkonzert auf dem Programm gestanden hatte.
Wir probten damals hier in unserem Ferienhaus in Gigaro und beschäftigten uns intensiv mit dem zweiten Satz. Vater spielte mir am Flügel vor, wie er die Orchestereinleitung des Adagios zu gestalten gedachte: ein fließendes Tempo, sehr streng und straff aufgebaut, ohne jegliche Schnörkel. Ich erschrak, als ich diese wunderbare Musik hörte, die für mich plötzlich so kalt und schroff klang.
Nach seinem Vorspiel sah er zu mir hoch und bemerkte wahrscheinlich mein Erstaunen über seine Auffassung der Partitur. Er runzelte die Stirn und stellte fest, dass er mich überfordert hatte. Da lächelte er leicht und erhob sich von seinem Hocker.
»Vergiss, was du soeben gehört hast«, meinte er. »Mache das, was du für richtig hältst und lasse dich von dem, was du soeben gehört hast, nicht beeinflussen.«
Als ich am Flügel saß, legte er seine Hand auf meine Schulter und flüsterte in bedeutungsschwangerem Tonfall, kaum hörbar: »Aber denk immer daran: Es ist Brahms.«
Читать дальше