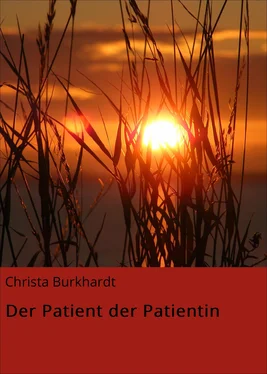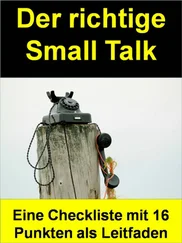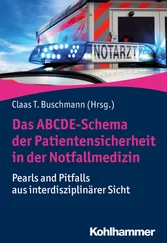„Darf ich mich zu dir setzen?“, fragte Severin, frisch geduscht und mit dem Lächeln auf den Lippen, das man nach einem erfüllten Tag lächelt. Sie lächelte zurück und nickte. Severin ließ sich in den zweiten Liegestuhl fallen. Gemeinsam beobachteten sie das Treiben im Garten.
Ein fleißig fütterndes Amselpärchen, Schmetterlinge, Hummeln, Licht- und Schattenspiele der sich leicht im Wind wiegenden Obstbaumblätter. Sie genossen die Geräusche der Umgebung mindestens so sehr wie ihr gemeinsames Schweigen.
„Warst du in der Bücherei?“, fragte Severin schließlich. Bücherei? Stimmt, darüber hatten sie ja am Morgen gesprochen, dass sie seine Bücher mit abgeben und seine Lieblingszeitschrift mitbringen würde. Bedauernd schüttelte sie den Kopf. „Hab‘ ich nicht geschafft“, sagte sie. Severin grinste. „Zu viel mit Nichtstun beschäftigt?“, fragte er. „Du hast es erfasst“, erwiderte sie.
Severin seufzte. „Das kenne ich.“ Wieder schwiegen sie. Die Amseln wurden unruhig, denn Kater Rhodos streifte durch den Garten und gesellte sich zu ihnen. Wenn er mich schon davon abhält, in Urlaub zu fahren, weil ich es nie im Leben übers Herz bringen würde, ihn allein zu lassen, soll er wenigstens einen Namen haben, der nach Sommer, Strand und Urlaub klingt, hatte sie vor zwei Jahren die Namenswahl begründet.
„Immerhin besser als Malle“, hatte ihre Tochter gesagt, Rhodos auf den Schoß genommen und herzlich willkommen geheißen. „Wenn es danach geht, verpasste Urlaubsziele lebendig werden zu lassen, musst du dir noch ganz schön viele Katzen anschaffen.“ „Rhodos reicht mir“, hatte sie nur geantwortet, „überall anders komm‘ ich schon noch hin.“
„Dr. Breitenbach hatte einen Unfall“, sagte sie nun zu Severin. „Du warst beim Arzt? Fehlt dir was?“ „Nein, ich habe nur Frau Jablonski getroffen. Sie hat es mir erzählt. Muss schlimm sein. Er liegt in einem Heim.“ Wieder schwiegen sie. Severin holte Eistee aus der Küche. Dann hingen sie wieder ihren Gedanken nach.
„Er geht dir nicht aus dem Kopf“, sagte Severin. Sie streichelte Rhodos hinter den Ohren. „Nein.“ Sie tranken noch einen Schluck und schwiegen wieder. Dieses herrliche Schweigen, in dem die Zeit stillsteht und mit dem alles gesagt ist.
Viel später stand Severin auf. Es wurde allmählich dunkel. Rhodos schnurrte immer noch auf ihrem Schoß. Er nahm Karaffe und Gläser und wandte sich zum Gehen. „Besuch‘ ihn“, sagte er und nickte zum Abschied.
Ein L-förmiger Zweckbau. Beton. Grau. Fenster an Fenster. Keines davon sah bewohnt oder gar einladend aus. Kein wenig Grün davor. Parken war hier verboten. Fahrradständer gab es nicht. Als ob sich hier niemand aufhalten soll, dachte sie. Unwirtlich. Ungastlich. Unmenschlich.
Sie wusste nicht mehr, warum sie Frau Jablonski nach dem Namen des Heims gefragt hatte. Aber sie hatte es getan. Und sie hatte sich den Namen sogar gemerkt. Nun stand sie davor. Besuch‘ ihn, hatte Severin vorgestern gesagt. Diese beiden Worte klangen seitdem in ihr nach.
Für Severin war das Leben einfach: Wenn einen etwas beschäftigt, beschäftigt man sich damit. Sonst hört es nicht auf und hält einen von den wirklich dringenden Beschäftigungen ab. Wenn einem etwas durch den Kopf geht, denkt man darüber nach. Sonst bleibt es Wirrwarr hinter den Schläfen und macht Kopfschmerzen. Sonst wird es klarer Gedanke. Wenn du etwas tun willst, dann tu es. Halte dieses Kribbeln in dir nicht länger als nötig hin. Steh‘ auf und leg‘ los. Sonst lähmt es Kopf und Körper. Wie konnte einer mit 22 so weise sein? Sie war es heute, mit 51 oft noch nicht. Besuch‘ ihn.
Nun stand sie da. Der Gehweg war schmal. Von der Bushaltestelle führte eine zwar kurze, aber enge und düstere Unterführung zum Eingang. War das so geplant, dass man sich schon auf dem Weg hierher dumpf und elend fühlen sollte? Wie auch immer so ein Heim hieß, lenkte der Name doch nur vor der einen wahren Tatsache ab: Hier war das Ende der Einbahnstraße. Hier ging es nur rein, aber nicht mehr raus. Endstation.
Warum regnete es eigentlich nicht? In der Nähe dieses „Heims“ konnte es nur ein einziges Wetter geben: Nieselregen, bewölkt, 10 Grad Celsius. Die Art Wetter, die einen von innen frieren ließ. Dementorenwetter nannte ihre Tochter als eingefleischter Harry-Potter-Fan das. Und genauso fühlte es sich an. Sie stand im Schatten, den das Gebäude an diesem späten Vormittag in den strahlenden Sommertag warf. Besuch‘ ihn, sagte Severin in ihren Gedanken wieder.
Sie machte einen Schritt, und die Automatiktür öffnete sich. Der Eingangsbereich war eifrig bemüht. Bemüht, einladend zu wirken. Bemüht, Sicherheit zu vermitteln, Zuversicht. Hier sind Sie gut aufgehoben, schrien grell der geschickt ausgeleuchtete Empfangstresen aus hellem Holz, die Yucca-Palmen an ausgesuchten Plätzen und die beiden deplatzierten und sicher kaum benutzten Sitzgruppen vor den Fenstern. Beige wie der Anstrich der Wände.
Sie durchschritt die kleine Halle und wandte sich zu den Aufzügen. Ins Auge fielen ihr zwei Getränke- und Snack-Automaten, die ein wenig Normalität vortäuschten und die Schilder „Notausgang“. Sie drückte auf die 3. Station B. Gerontopsychiatrie. Was um alles in der Welt hatte Dr. Breitenbach in der Gerontopsychiatrie zu suchen? Er war kaum älter als sie und sicher nicht dement.
Sie lief den Gang entlang. Zimmer 321. Klang diese Zahl nur in ihren Ohren wie ein Countdown? Null, dachte sie, und klopfte. Keine Antwort. Sie atmete auf. Na also. Er war gar nicht hier. Oder er wollte niemanden sehen. War sie überhaupt willkommen? Sie hatte keine Ahnung. Sie hatte es versucht. Sie hatte ihr Bestes gegeben. Sie war gekommen. Sie hatte das Zimmer gefunden. Sie hatte geklopft und keine Antwort bekommen. Sie hatte sich bemüht. Sie hatte alles getan, um ihren vagen Vorsatz umzusetzen. Es sollte nicht sein.
Was hatte sie schon hier zu suchen? Sie war doch nur eine ehemalige Patientin. Sie kannte diesen Mann eigentlich gar nicht und hatte ihn mindestens drei Jahre nicht mehr gesehen. Sie konnte einfach wieder gehen. Sie klopfte noch einmal und trat ein. Links die obligatorische Nasszelle, dann öffnete sich der Raum. Rechts die großen Fenster. Die Wände blassgelb. Links stand nur ein Bett. Daneben Monitore, allerlei Apparate. Sein Bett, seine Monitore, seine Apparate. „Herr Breitenbach“, sagte sie leise und trat näher heran.
Er rührte sich nicht. Hatte er seine Augen offen oder geschlossen? Sie konnte es nicht erkennen. Leise ging sie noch näher heran. Der Anblick schockierte sie nicht. Sie hatte damit gerechnet und kannte diesen schwer kranker Patient im Krankenhausbett-Anblick. Ihr Schwiegervater war nach jahrelangem Leiden an Lungenkrebs gestorben, sie hatte ihre eigene Mutter bis zu ihrem Tod täglich besucht.
Sie kannte diesen Anblick einer kleinen, blassen menschlichen, nein, entmenschlichten Gestalt in der Übermacht medizinisch weißer Sterilität. Natürlich, den gab es hier auch zu sehen. Damit hatte sie gerechnet. Was ihr hier die Luft zum Atmen nahm, sie taumeln ließ und ihr den Boden unter den Füßen wegzuziehen drohte, war diese mit Händen zu greifende Hoffnungslosigkeit. Hier war Endstation, aber das Ende ließ diesen Mann nicht herein. Hier parkte ein Mensch, hier war ein Mensch geparkt, der nicht mehr Mensch sein konnte. In Zimmer 321 fehlte die Würde.
„Herr Breitenbach?“, versuchte sie es noch einmal und wunderte sich, wie normal ihre Stimme klang. In Gedanken rannte sie längst schreiend die Treppe hinunter, weg, nur weg hier. „Herr Breitenbach? Ich bin Linda Keller.“ Seine Augen waren offen, aber er schaute sie nicht an. Er schaute nirgendwohin. „Soll ich wieder gehen?“, fragte sie. Er antwortete nicht.
Später hätte sie nicht mehr sagen können, warum sie das tat. Eigentlich tat sie es auch gar nicht. Irgendetwas in ihr tat es. Ließ es sie tun. Sie trat an sein Bett und nahm seine Hand. „Herr Breitenbach?“, sagte sie noch einmal leise. Dann wartete sie. Sie ließ seine Hand nicht los. Sie wusste nicht, wie lange sie dastand und schwieg.
Читать дальше