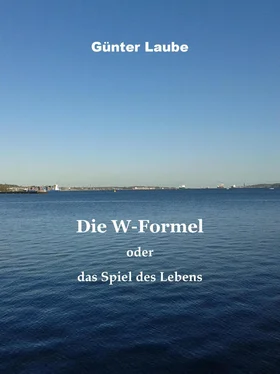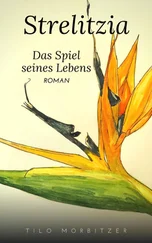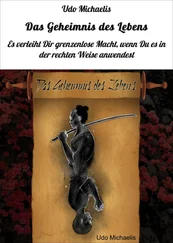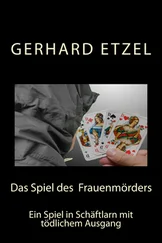1 ...6 7 8 10 11 12 ...25 »1. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.
2. Du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht mißbrauchen.
3. Denk an den Sabbat; halte ihn heilig.
4. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das Jahwe, dein Gott, dir gibt.
5. Du sollst nicht morden.
6. Du sollst nicht die Ehe brechen.
7. Du sollst nicht stehlen.
8. Du sollst nicht falsch Zeugnis gegen einen anderen aussagen.
9. Du sollst nicht die Frau eines anderen begehren.
10. Du sollst nicht das Haus eines anderen begehren, seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, was dem anderen gehört.
Nach dem Zweiten Buch Mose 20, 2-17«
Wie bei einem Vergleich der verschiedenen Versionen auffällt, gibt es durchaus Unterschiede. Doch im Großen und Ganzen sind die Versionen gleich - vom Sprachgebrauch, der sich bereits in wenigen Jahrzehnten verändert, einmal abgesehen.
Die Zehn Gebote sind auch über den jüdischen Religionskreis hinaus bekannt und zählen wohl zu den bekanntesten und populärsten Inhalten des jüdischen Glaubensbekenntnisses. Das achte Gebot kennen wir auch als »Du sollst nicht lügen!«, und bei den meisten Geboten handelt es sich um negative Gebote, also um Verbote. Ähnliche Gebote finden sich auch bei Buddha und Konfuzius, also im fernöstlichen, asiatischen Raum, sowie im Koran.
Das Judentum gilt gemäß Brockhaus als Mutterreligion von Christentum und Islam, und je nach Quelle gibt es weltweit zwischen 13 und 15 Millionen Juden. Der Großteil lebt außerhalb Israels, nur drei von vier der 6,6 Millionen Einwohner sind jüdischen Glaubens, 15 Prozent sind Muslime. Im Großraum New York leben zwei Millionen Juden und in den USA mit 5,7 Millionen mehr als in ganz Israel.
Über die Geschichte des Judentums und »Gottes auserwähltes Volk« ( stern ) hat jeder in der Schule gehört, dazu kann man sich heutzutage aus den unterschiedlichsten Quellen unterrichten und in die Materie vertiefen. Einige Stichpunkte seien hier angeführt: Im 13. Jahrhundert erfolgte unter Moses der Auszug aus Ägypten, im zehnten Jahrhundert vor Christus war die Zeit von König David und seinem Sohn Salomo. Es war eine Art Blütezeit, Jerusalem wurde Hauptstadt, und bedingt durch seine Lage zwischen Ost und West, eine Art Zentrum des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens, gekrönt vom Bau des Tempels Salomos, dessen Inneres die Bundeslade beherbergte. Nach Salomos Tod ging es jedoch bergab, Konflikte brachen auf, das Land zerfiel in zwei Reiche: Israel und Juda. Der Tempel und Jerusalem wurden 587 vor Christus durch Nebukadnezar zerstört, gefolgt vom Babylonischen Exil. Im ersten Jahrhundert vor Christus wurde Palästina römische Provinz, im siebten Jahrhundert nach Christus von den Arabern erobert. Der negative Höhepunkt der Judenverfolgungen war schließlich mit dem Beginn der Nationalsozialistischen Machtübernahme in Deutschland und den Deportationen in Konzentrationslager erreicht, die mit der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 1938 ihren Anfang nahmen. »Der Holocaust beschleunigte die Gründung des Staats Israel« ( National Geographic ), und es wanderten Juden aus aller Welt nach Palästina. Eine weitere große Flüchtlingswelle war in den 1990er Jahren zu beobachten, in denen mehr als eine Million Juden aus der ehemaligen Sowjetunion nach Israel zog. So weit einige Details zum geschichtlichen Verständnis. Etliches dürfte weitestgehend bekannt sein, doch wir wollen uns auf der Suche nach den Prinzipien für die W-Formel nun an die eigentliche Quelle dieser Religion halten: Das Alte Testament, das im Christentum ebenfalls als Quelle gilt und im Buch der Bücher, der Bibel, an erster Stelle steht.
Die Genesis und der Exodus sind zwei der fünf Bücher Mose, der jüdischen Torá - dem Gesetz -, und mit der Genesis beginnt die Erschaffung der Welt. Wenn zwei Weltreligionen diese Quelle nutzen, lohnt sich ein Blick in das erste Buch Mose, der Genesis, auf jeden Fall. Vielleicht erhalten wir daraus ein paar Ansatzpunkte für unsere Prinzipien, für die W-Formel. Denn es gibt sogar Judenchristen, Menschen, die unter Beachtung und Beibehaltung der jüdischen Gesetze des Moses Christen wurden. Schauen wir also, was das Alte Testament über »die Erschaffung der Welt« zu berichten weiß, denn so heißt das erste Kapitel.
In den Versen drei bis fünf sprach Gott: »Es werde Licht, und es wurde Licht«, und »Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und es wurde Morgen: erster Tag.«
Dieses Schema wiederholt sich, ein zweiter und ein dritter Tag kommen ins Spiel. So weit, so gut. Doch in Vers 14, der den vierten Tag einläutet, sprach Gott: »Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen.«
Nanu?
Wie soll das funktionieren, wenn er am vierten Tag erst die Tage macht? Oder um es genauer zu sagen: die Lichter am Himmelsgewölbe, die Tag und Nacht voneinander scheiden, sprich Sonne und Mond. Ohne die gibt es bekanntlich keine Tage und keine Nächte, denn ein Tag ist nun einmal die Zeit, die die Erde braucht, um sich einmal um sich selbst zu drehen und die Sonne wieder dort zu sehen, wo sie einen Tag zuvor auch stand. Und macht sie das ungefähr 365mal, ist sie in dieser Zeit sogar einmal um die Sonne rumgefahren, das ist dann ein Jahr.
Ohne Sonne und Mond können wir den Kalender und die Zeitrechnung also eigentlich vergessen, doch in der Genesis geht es noch weiter: Am fünften Tag schuf Gott »alle Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln« (Vers 21). Und schließlich der sechste Tag, das Mammutprojekt: »Gott machte alle Arten von Tieren des Feldes, alle Arten von Vieh und alle Arten von Kriechtieren auf dem Erdboden« (Vers 25). Und »dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich« (Vers 26).
Nanu?
Wer ist denn noch da? Ich denke, es handelt sich um eine monotheistische Religion, warum spricht Gott von sich in der Mehrzahl? »Lasst uns ...« ist ein eindeutiger Begriff, anders als »Gott sah« oder »Gott sprach«. Und wie zur Bestätigung meiner Verwirrung kehrt er in Vers 27 zurück zu seinen Wurzeln: »Gott schuf also den Menschen als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie.«
Nicht, dass ich mich über Details wundern will, aber hier nimmt es einer offenbar sehr genau. Doch weiter im Text: Der sechste Tag beschließt das erste Kapitel, das zweite beginnt mit dem siebten Tag, an dem Gott ruhte. Und hier setzt mein Verwirrungsprozess wieder ein. Denn in Vers sieben »formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem.«
Zweierlei fällt auf: Gott ist nun »Gott, der Herr«, und es gibt die nächste Variante der Menschwerdung. Eben waren wir noch nach Mehrheitsbeschluss als Gottes Abbild und als Mann und Frau geschaffen worden, und jetzt werden wir aus Erde gemacht und kriegen Luft zum Atmen. Doch damit nicht genug, »nahm Gott, der Herr, den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte« (Vers 15). Vorher hatte er noch schnell alles angelegt, was wir zum Leben brauchen, Bäume mit Früchten und vier Flüsse, doch leider auch zwei Bäume, die uns noch schwer im Magen liegen sollten: »den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse« (Vers 9).
Vor letzterem wurden wir gewarnt: »Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen; denn sobald du davon isst, wirst du sterben« (Verse 16-17).
Weshalb pflanzt Gott einen giftigen Baum ins Paradies?, frage ich mich, doch nun kommt die Stelle, wo es noch einmal richtig interessant wird: Gott machte eine Frau aus der Rippe (Vers 22) »und führte sie dem Menschen zu«. In Vollnarkose versteht sich, denn zuvor hatte er »einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen« lassen (Vers 21). Der Grad meiner Verwirrung nimmt zu. Ein Kapitel zuvor hatte Gott noch den Menschen als Mann und Frau geschaffen, also gleichzeitig, und jetzt wird die Frau nach dem Mann geschaffen. War somit der erste Mensch ein Mann?
Читать дальше