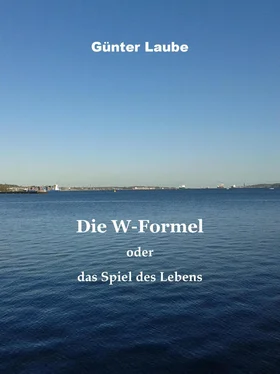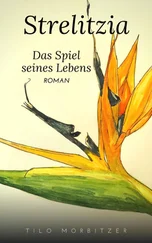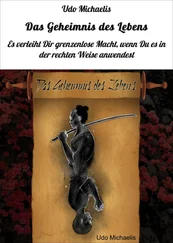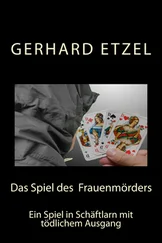Gute Geister, böse Geister, gute Menschen, böse Menschen? Sie begegnen uns in Märchen und Mythen, aber gibt es wirklich Geister? Oder glauben nur so genannte Naturvölker, Esoteriker und einige Kirchenvertreter an die Existenz von Geistern, bösen und guten? Muss man einen Geist gesehen haben, um an ihn zu glauben? So wie es der Piraten-Captain im Film »Fluch der Karibik« im Gespräch mit Keira Knightley ausdrückte: »Es ist besser, Ihr beginnt an Geistergeschichten zu glauben, Miss Turner. Ihr steckt in einer drin!«
»Gäa, Göttin alles Lebens, die Erde, Gemahlin des Uranos«, steht bei Gustav Schwab zu lesen. Deren Söhne waren die Giganten. Uranos, der Vater des Kronos, und dessen Sohn Zeus, der eine ganze Reihe von Kindern in die Welt setzte, dürften jedem ein Begriff sein. Die Kinder des Gottes mit den Blitzen tummelten sich vorrangig im Nahen Osten, schließlich ist er eine griechische Gottheit. Doch selbst auf der Osterinsel in der Südsee künden riesige Statuen von Kulten oder religiösen Momenten in vergangenen Zeiten. »Seit je versuchen die Menschen, den Sinn ihrer Existenz zu ergründen und die Natur zu verstehen. Aber mit der Kultur wandelte sich stets auch der Glaube, neue Religionen entstanden.« ( National Geographic )
Hierauf aufbauend, könnte man in gewisser Weise jedem Gärtner einen Hang zur Naturreligion attestieren, da er ja den Boden, auf dem er lebt und dem alles zu Grunde liegt, bearbeitet. Eine weitere Variante steuern schließlich die orientalischen Lehren bei: Hinduismus, Buddhismus, Taoismus, Konfuzianismus. Ian Stevenson, Professor für Psychiatrie an der Universität von Virginia, untersuchte auf wissenschaftlicher Grundlage in den 1960er Jahren Reinkarnationsfälle aus drei Kontinenten inklusive ausführlicher Dokumentation. Von Indien bis Brasilien und Alaska. Das Thema der Wiedergeburt, die Erinnerung an ein früheres Leben, zieht sich wie ein roter Faden durch gewisse Kulturkreise und tritt vereinzelt auch in der westlichen Welt auf, im Okzident. Genau wie Ian Stevenson dokumentierte auch Thorwald Dethlefsen zahlreiche Fälle, in denen er Patienten per Hypnose in frühere Zeiten zurückversetzte. Er deutete es als Hilfsmittel für den Zugang zum Unbewussten des Patienten bzw. zum Unterbewusstsein. Es ist nur so eine Vermutung am Rande, aber irgendwo in meinem müssen noch ein paar Vokabeln liegen, die ich zwar irgendwann mal gelernt, aber in den Vokabeltests dann nicht mehr parat hatte. Verschüttet.
Während das Gebiet des Hinduismus im Laufe der Zeit kaum eine geographische Veränderung erfuhr, hat sich der Einflussbereich des Buddhismus örtlich gewandelt: »Der Buddhismus hat außerhalb seines Ausgangsgebietes die meisten Anhänger: drei Viertel aller Japaner, jeder zehnte Chinese zählen ebenso dazu wie über eine Million in Nordamerika und in Europa. Das hauptsächliche Verbreitungsgebiet liegt jedoch in Südostasien«, berichtete Der Spiegel 1998. Religionen sind also einem Wandel unterworfen, und zwar sowohl in geographischer als auch in zeitlicher Hinsicht. Aber kann man mit Religionen die wirklich wichtigen Fragen klären?
»Das menschliche Bewusstsein wirft Fragen auf, die durch Fakten, Vernunft und Beobachtung nicht zu beantworten sind. Wer bin ich? Warum bin ich auf der Welt?« ( National Geographic )
Können uns die Religionen darüber wirklich eine erschöpfende und befriedigende Antwort geben? Oder ist und bleibt alles eine Frage des Glaubens? Betrachten wir die Frage mal in Anlehnung an unsere Prinzipien: Wieviele und welche Religionen gibt es überhaupt?
Dafür müssen wir konkret werden und eine Auswahl treffen, wobei wir uns an die bekanntesten Religionen halten sollten, die je nach Quelle auch als Weltreligion bezeichnet werden, und denen die größte Anhängerschaft zuerkannt wird. Diese wollen wir uns jetzt einmal im Detail anschauen, und zwar Schritt für Schritt.
II.2. Der G-Begriff
Die indische Religion zählt zu den ältesten Religionen der Welt. Je nach Quelle werden 800 Millionen bis zu einer Milliarde Menschen als Anhänger oder Bekenner des Hinduismus gezählt. In einem von Franz Hartmann übersetzten Auszug aus der Bhagavad-gita zitiert dieser Wilhelm von Humboldt, der Gott dafür dankte, dass er ihn so lange habe leben lassen, um dieses Werk kennen zu lernen.
Durch Menschen wie Mahatma Gandhi, dessen gewaltloser Kampf beispielhaft war und ist, und dem Indien die Unabhängigkeit vom englischen Empire verdankt, wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewisse Aspekte beleuchtet. Das Prinzip der Briten, Baumwolle aus Indien nach Großbritannien zu exportieren, damit die Produkte anschließend wieder importiert wurden, war ein großes Geschäft. Ein noch größeres war das Salz, das quasi vor der Haustür der Inder lag, aber die Briten hatten per Definition des Stärkeren ein Salzmonopol, und damit mussten die Inder ihr eigenes Salz kaufen. So begründet man ein Weltreich. Gandhi lebte seinen Landsleuten vor, wie man dem begegnen könnte, legendär ist seine über dreiwöchige Wanderung im Alter von 60 Jahren mit dem Stab ans Meer, um dort eine kleine Menge Salz in die Hand zu nehmen.
Auch durch Rabindranath Tagore, der 1913 als erster Nichteuropäer den Literatur-Nobelpreis erhielt, wurde die indische Philosophie im Westen populär. Tagore wurde 1921 beim Besuch in Deutschland empfangen wie heutzutage der Dalai Lama - mit spiritueller Sehnsucht, noch stärker im Grunde als heutzutage der weltbekannte Buddhist. Er galt als Philosoph und Mystiker, als »Weiser des Ostens«.
Die Veden oder der Veda, das Wissen oder Wort ist bzw. sind die ältesten religiösen Aufzeichnungen, doch: »Die erste Periode in der Geschichte der religiösen Entwicklung der Inder verliert sich im Dunkel der Legende«, schreibt Helmuth von Glasenapp. »Die Bhagavad-gita, ein philosophisches Gedicht von 700 Strophen, in welchem Krishna dem Arjuna die Lehre von der Erlösung durch Gottesliebe verkündet«, ist im Heldenepos Mahabharata enthalten. Ein Beispiel sei an dieser Stelle zitiert: »Von allen Schöpfungen bin Ich der Anfang, das Ende und auch die Mitte, o Arjuna. Von allen Wissenschaften bin Ich die spirituelle Wissenschaft des Selbst, und unter den Logikern bin Ich die schlüssige Wahrheit.« (Kapitel 10. Vers 32)
Das klingt sehr blumig, eben orientalisch, und in den Ohren eines Europäers halbwegs mystisch. Doch es wird noch unbestimmter, denn der Hinduismus und sein Götterpantheon sind legendär. Es gibt weibliche Gottheiten, Kali und Durga, und männliche, Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, Indra, Agni, Krishna, außerdem den Dämonenkönig Ravana und Hanuman.
Da soll sich einer auskennen! Auf jeden Fall steht diese Anschauung recht deutlich im Gegensatz zu den Lehren der monotheistischen Religionen, und eine kann schließlich nur richtig sein, oder?
Der Gottesbegriff, die Göttervielfalt der Inder erinnert mich jedenfalls an die Griechen, die über ein ebenfalls recht buntes Götterbild verfügten: Uranos, Kronos und Zeus sind wir bereits begegnet. Des Weiteren gab es Apollo, Hermes, Poseidon, Aphrodite, Hephaistos ...
Stop!
Dem kundigen Leser wird bereits aufgefallen sein, dass es sich bei den griechischen Göttern um unsere Planeten handelt. Oder besser ausgedrückt: Die römische Version mancher griechischen Gottheit wurde den Planeten unseres Sonnensystems als Name beigelegt. Waren die Planeten also für die alten Griechen Götter? Oder glaubten die Römer, dass die Griechen es glaubten? Bei den Indern war es jedenfalls nicht so, auch wenn ein wesentlicher Aspekt der indischen Weltanschauung der der Vielgötterei war und ist. Es ist gewissermaßen für jeden etwas dabei, und neben den drei populärsten, Brahma, Vishnu und Shiva, dem Weltschöpfer, dem Welterhalter und dem Weltzerstörer, gibt es noch viele weitere: Ganesha, den Vernichter der Hindernisse, Indra, den Gewittergott, Skanda, den Kriegsgott, Agni, den Feuergott, Varuna, den Wassergott, Vayu, den Windgott, Surya, den Sonnengott, Soma, den Mondgott, Yama, den Todesgott, Kama, den Liebesgott.
Читать дальше