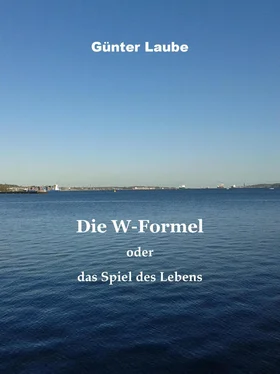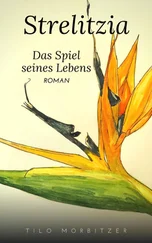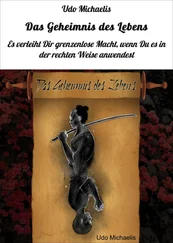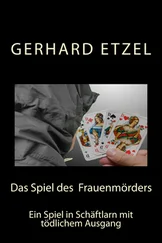»Ich könnte losziehen mit der Frage im Kopf: Gibt es Gott? Oder Jahwe, Shiva, Ganesha, Brahma, Zeus, Ram, Vishnu, Wotan, Manitu, Buddha, Allah, Krishna, Jehowa?«
(Hape Kerkeling)
Abraham gilt den drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum und Islam als Stammvater. Er ist im Allgemeinen deswegen bekannt, weil er noch im hohen Alter von 100 Jahren einen Sohn mit seiner Frau Sara, die bereits 90 Jahre alt war, zeugte und diesen später auf Gottes Geheiß opfern sollte. Was er auch durchzuführen gedachte. Doch im letzten Moment erschien ihm ein Engel, und Abraham opferte statt seines Sohnes einen Widder, der sich in einem nahen Gestrüpp verfangen hatte. Der Name Abraham bedeutet »Vater der Menge«, und in der Bibel steht, dass Gott ihm sagte: »Du wirst Stammvater einer Menge von Völkern« (Genesis 17,4). Der Ausgangspunkt dieser Religionen liegt in einem geographisch sehr engen Gebiet, auf der arabischen Halbinsel, im Nahen Osten. Damit haben wir bereits drei Weltreligionen benannt, doch welche gibt es noch?
Einige Jahrhunderte vor Christus lehrten Buddha, Lao-Tse und Konfuzius in Indien und China. In Indien war der Hinduismus die dominierende Religion, die älteste polytheistische Religion der Welt. Sofern man von den Naturvölkern absieht, die Naturreligion praktizierten. Die alten Griechen wiederum hatten ihre Mythologie, in Persien gab es Zoroaster, auch Zarathustra genannt, und Manitu dürfte jedem ein Begriff sein, der jemals Indianergeschichten gehört oder gelesen hat. Es gibt also in der Tat eine Fülle von Religionen, doch »was nützt Religion?«
Mit dieser Frage provozierte das Nachrichtenmagazin Focus im Dezember 2006 seine Leserschaft. Kurz vor Weihnachten machte sich jeder so seine Gedanken ob dieses Themas. Denn grundsätzlich ist es eine berechtigte Frage. »Mal abgesehen von der Wahrheitsfrage, macht der Glaube glücklicher und gesünder? Dient er der Gesellschaft? Oder gibt es noch andere Gründe, wieso Menschen zu Beginn des dritten Jahrtausends Religion noch brauchen? Was also nützt Religion?«
Was bringt Menschen zum Beispiel dazu, von überall her nach Mekka zu pilgern, sich an Regeln zu halten, wie fünf tägliche Gebete, den Haddsch zu begehen, die Pilgerfahrt, den Weg, den jeder Muslim einmal in seinem Leben gehen muss.
Braucht man Religion manchmal oder nur in Ausnahmesituationen? In großer Not und von schwerer Krankheit heimgesucht verrichtete Robinson Crusoe sein erstes Gebet seit Jahren, nachdem er auf der Insel gestrandet war und sich bewusst wurde, dass er »die Wege der Vorsehung verkannt hatte«.
Oder braucht man Religion immer, in allen möglichen Formen und Varianten, wie zum Beispiel in Brasilien? »Im größten katholischen Land der Welt beten Millionen Menschen zu schwarzen Göttern, wächst die Anhängerschaft zahlloser Sekten und Naturreligionen«, berichtete Der Spiegel 1978. Es beteten Millionen zu heidnischen Göttern, die vor allem afrikanischen Ursprungs waren; weiße und schwarze Magie, Voodoo und Kulte herrschten unter der Bevölkerung. Althergebrachten religiösen Einstellungen und neuen Ansichten begegnen wir auch im Film »Volver - Zurückkehren« oder im Vampir-Film »From Dusk till Dawn«, in dem George Clooney Harvey Keitel, den von Zweifeln geplagten Priester, fragt: »Wie kann Gott existieren, wenn dir und deinen Kindern deine Frau weggenommen wird?«
Clooney, der den Verbrecher Seth verkörpert, wird inzwischen als Mörder von der Polizei gejagt, und er glaubte bisher nicht an Vampire. Aber angesichts der Tatsachen, mit denen er in der Spelunke konfrontiert wurde, und die in einem orgiastischen Blutbad endeten, »hatte er seine Lebensmaxime vor 30 Minuten geändert: Was immer da draußen ist und versucht zu uns zu kommen, ist das pure Böse, direkt aus der Hölle. Aber wenn es eine Hölle gibt, aus der diese Monster kommen, dann muss es auch einen Himmel geben, Jakob!«
Diese Logik entwickelte im indonesischen Urwald auch Sabine Kuegler, das »Dschungelkind«, gegenüber Bebe, einem Eingeborenen vom Stamm der Fayu: »Wer ist Tohre?«
»Er ist der böse Geist; er kommt nachts aus dem Urwald und frisst einen auf. ... Er frisst das Leben im Körper.«
»Und wie heißt dann der gute Geist?«
»Was für ein guter Geist? Es gibt keinen guten Geist!«
»Es muss doch auch einen guten Geist geben, wenn es einen bösen gibt.«
»Bebe schaute mich verdutzt an. Nein, es gab definitiv keinen guten Geist. Wie traurig, dachte ich mir. Jetzt verstand ich, warum die Fayu nachts nicht gern ins Freie gingen«, schreibt das Dschungelkind.
»Dschungelkind?«, mag sich jetzt mancher fragen, dem sind wir doch eben schon kurz begegnet? Stimmt, und das macht eine kurze Exkursion erforderlich, wir springen in die Mitte des 20. Jahrhunderts: Auf einem Vortrag eines Freundes von Albert Schweitzer entschied sich ein junges Mädchen im Alter von zwölf Jahren, später Entwicklungshelferin zu werden. Die Grundlage lieferten eine Ausbildung zur Krankenschwester und die Heirat mit einem Mann, der später ebenfalls in den Entwicklungsdienst gehen wollte. Nach einer entsprechenden Sprachausbildung und der Geburt ihrer ersten Tochter, Judith, begannen Doris und Klaus-Peter Kuegler ihre Arbeit in Nepal. Dort wurde 1972 Sabine geboren, zwei Jahre später ihr Bruder Christian. Nach einem Zwischenstopp in Deutschland ging es für die Familie am 23. April 1978 nach West-Papua, Indonesien. Hier lebten Sprachforscher, Anthropologen, Missionare und Piloten zusammen in einer kleinen Siedlung namens Danau Bira, mitten im Urwald.
Sie richteten sich ein, und eines Tages entdeckte Klaus-Peter Kuegler auf einer seiner Expeditionen einen neuen Eingeborenen-Stamm: die Fayu, die seit Generationen in einem Kreislauf des Tötens gefangen waren. Der Stamm war in vier Gruppen getrennt, die sich gegenseitig befehdeten und jede ihre eigenen Gebiete hatten. Als über eingeborene Dolmetscher mühevoll ein erster Kontakt hergestellt werden konnte, wurde der Vater des Dschungelkindes gefragt, was er hier wolle. Er antwortete, dass er überlege, ob er mit seiner Familie hierher ziehen solle, da er mit ihnen leben und ihnen eine Botschaft von Liebe und Frieden bringen wolle. Die Antwort des Fayu-Kriegers: »Ich möchte nicht mehr Krieg führen und Menschen umbringen. Bitte komm wieder!«
Sie verabredeten ein Treffen, drei Monate später. Bei diesem Treffen lernte Sabines Vater Häuptling Baou kennen, der als der gefährlichste und kaltblütigste Fayu-Krieger galt. Dieser gab sein Einverständnis, dass die Kueglers zu ihnen ziehen sollten, und er wies ihnen auch direkt einen Grund und Boden für ihr Haus zu: in der neutralen Zone zwischen allen vier Stämmen. Zur weiteren Arbeit zog 1980 die ganze Familie in das »Verlorene Tal«, in die Nähe eines Stammes, bei dem es noch Kannibalismus gab und Gewalt und Brutalität zum Alltag gehörten. Auch gegenüber den eigenen Frauen.
Sabine war sieben Jahre alt, als die Familie umzog, und viele Jahre später, als sie beurteilen konnte, wie es in Europa und in Deutschland aussah, brachte sie ihre Erinnerungen zu Papier. Der Name »Dschungelkind« ergab sich quasi von selbst: »Ich lernte den Dschungel zu respektieren und ihn auch zu beherrschen, soweit das einem Menschen möglich ist. In den Wochen und Monaten nach unserer Ankunft wurde ich wie Tuare: ein Kind des Dschungels.«
Tuare war ein Fayu und der beste Freund und Spielkamerad von Sabine. In den folgenden Jahren tauten die Fayu-Kinder allmählich auf. Sie waren seit jeher in der Spirale von Hass, Angst und Tod gefangen, kannten keine Spiele, es galt die Blutrache. »Keine Liebe, keine Vergebung, keinen Frieden und keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft«, schreibt das Dschungelkind. Die Sterblichkeitsrate lag bei 70 Prozent für Neugeborene, die Lebenserwartung betrug 30 bis 35 Jahre. Die Fayu wussten keinen Ausweg aus dem Gesetz der Blutrache - auch wenn sie eigentlich Frieden wollten und keinen Tod. Klaus-Peter Kuegler und seine Familie waren für sie die Hoffnung, aus dem Teufelskreis ausbrechen zu können.
Читать дальше