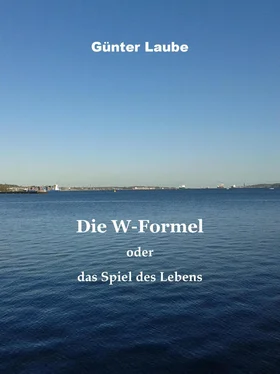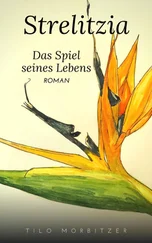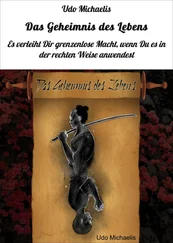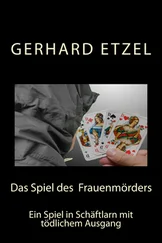Unsere Exkursion nach West-Papua der 1980er Jahre ist damit beendet, wir werden auf unserer Reise allerdings immer mal wieder hierher zurück kehren. Doch zunächst halten wir uns an das Prinzip. Parallelen zum Schamanismus, im Grunde eine Art Vorläufer von Religion, in der der Kontakt zur Geisterwelt hergestellt wurde, sind unübersehbar.
Im Grunde herrscht also überall auf der Welt eine Mischung von verschiedenen Glaubensrichtungen. Auch in Jerusalem, der Heiligen Stadt, herrscht eine Religionsvielfalt, und es vergeht keine Woche, ohne dass Angehörige einer der drei großen Religionen eines ihrer frommen Feste feiern. Diese Tatsache entstammt dem Marco Polo-Reiseführer »Jerusalem« und dokumentiert, welche zentrale, ja dominante Rolle diese Stadt für Gläubige unterschiedlicher Konfessionen spielt, was sich wiederum auf viele Mitmenschen auswirkt. Durch diverse Kalenderreformen und durch die Orientierung der Juden am Mondkalender haben sich zwar die Daten einzelner Feste verschoben, doch die Grundprinzipien blieben erhalten. Der Mondkalender wiederum führt uns im Grunde zurück zu den Naturreligionen, die modernen Glaubensrichtungen hingegen zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen Verkünder oder Lehrer oder Begründer aufzuweisen haben. Die zahlreichen Götter und Geister, die Hape Kerkeling aufzählte, entstammen verschiedenen Religionen, und jede birgt ihr eigenes Anschauungssystem, bis hin zur Wiedergeburt und dem Karma, das in den orientalischen Religionen, dem Hinduismus und dem Buddhismus eine Rolle spielt. Doch welche Religion und welche Götter stellen nun die richtige Glaubensrichtung dar bzw. welcher Gott ist der höchste Gott? Oder sind alle Religionen und alle Götter gleich?
Damit stellt sich eine weitere Frage, nämlich wie eine Religion oder Religion überhaupt zu Stande kommt? Um das zu klären, hilft eine klare Definition, was denn Religion überhaupt ist. Die Herkunft des Wortes »Religion« ist nicht endgültig geklärt, gemäß Brockhaus stammt es vom lateinischen »religio«, was »Gottesfurcht« bedeutet und laut Cicero wiederum zum Verb »relegere« in Beziehung steht: sorgsam beachten. Eine andere Variante steuern Lactantius und Augustinus bei, die »religio« vom Verb »religare« - verbinden - ableiten. Dies klingt zumindest plausibel, geht es doch darum, die Verbindung zur göttlichen oder geistigen Welt herzustellen. So wie die Naturvölker es vormachten.
Um noch einmal aus dem Brockhaus zu zitieren: Bei Religion handelt es sich um »ein (Glaubens-)System, das in Lehre, Praxis und Gemeinschaftsformen die >letzten< (Sinn-)Fragen menschlicher Gesellschaft und Individuen aufgreift und zu beantworten versucht. Diese >religiöse Frage< stellt sich in verschiedenen Kulturen und zu verschiedenen Zeiten in je anderer Form.« Die verschiedenen Formen sind im Grunde entweder monotheistischer Natur, wie Judentum, Christentum und Islam, oder polytheistischer Natur, wie Naturreligionen und Hinduismus. »Religionssoziologisch lassen sich Religionen charakterisieren als Welterklärungs- und Lebensbewältigungssysteme.«
Religion bedeutet also die Verbindung oder auch die Wiederverbindung mit der geistigen Welt und soll uns dabei helfen, das Leben zu bewältigen oder zu meistern. Die meisten Religionen hatten einen Verkünder, einen Propheten, einen Lehrer, einen Begründer. Ist das so, als ob man auf die Tipps oder Ratschläge von anderen, Älteren oder Lehrern hört? Diese Frage führt uns kurz zurück in meine Kindheit:
Ein Fußballturnier steht auf dem Programm. Wir müssen zwar fahren, doch zahlreiche Eltern sind da und wollen ihre Sprößlinge anfeuern. Oder mal mit anderen Eltern schnacken. Unser Trainer, mein Vater, hat uns eingehend instruiert, wir haben eine Taktik, das Turnier ist halbwegs ausgeglichen besetzt, wir könnten bis ins Halbfinale kommen, mit etwas Glück sogar ins Finale. Als wir gegen eine Mannschaft antreten, die mit einem eher kleinen Torwart spielt, nimmt er mich kurz vor Anpfiff zur Seite, macht mich darauf aufmerksam und ermuntert mich, mal aus der Entfernung zu schießen. Er weiß, dass ich einen ganz ordentlichen Schuss habe. Während des Spiels ergibt sich tatsächlich eine Situation: Ich bekomme den Ball und bin nicht mehr weit vom gegnerischen Strafraum entfernt, so ungefähr 20 bis 18 Meter in zentraler Position. Ich schieße.
Der Torwart fliegt, doch der Ball ist zu hoch für ihn. Tor!
Im ersten Moment bin ich sprachlos. Dann brechen alle Dämme. Na gut, kein brasilianischer, aber immerhin norddeutscher Jubel, und schon ein bisschen ekstatisch, denn es ist das 1:0 für uns. Von nun an läuft es besser, man könnte sagen: Wir kommen besser ins Spiel, und bald schießt ein anderer von uns das 2:0. Beim gegnerischen Team gibt's einen leichten Knick. Doch sie kommen noch mal und schaffen den Anschlusstreffer. 2:1. Wir haben das Spiel nach vorne jedoch nicht eingestellt, keine Abwehrschlacht oder so, wir greifen an. Unsere Stürmer sind gedeckt, aber ich stehe wieder frei vor dem gegnerischen Sechzehner. Diesmal sogar noch etwas weiter, über 20 Meter. Aber als ich den Ball bekomme, schieße ich wieder. Nach den guten Erfahrungen, die ich gemacht habe, und wer weiß, was einmal klappt...
Es ist das Tor des Tages. Mindestens. Links oben in den Winkel, der Torwart hätte auch zwei Meter zehn groß sein können, er hätte ihn nicht gehalten. We are the Champions!
Doch hätte ich die Tore auch geschossen, wenn mein Vater mich nicht zum Schießen ermuntert hätte?
II.1. Wieviele?
Untrennbar verbunden mit Religion ist der Begriff von Gut und Böse. Gute Geister, böse Geister: Luzifer, Beelzebub, Satan, Teufel, Fürst der Dunkelheit, der oder das Böse, Mephistopheles, Antichrist. Die Liste ließe sich fortsetzen, und im Tierreich sind die populärsten Begriffe für diesen geistigen Widersacher Schlange und Drache. Doch die Schlange gilt auch als Symbol für die Weisheit, und im Falle des Medizinwesens sogar für eine heilige Wissenschaft. Da soll einer schlau draus werden!
Zarathustra, bei den Griechen Zoroaster genannt, hat mit der ersten großen Religion sowohl griechische Philosophen als auch Judentum und Christentum beeinflusst. Die Anfänge verlieren sich im Dunkel der Geschichte, und heutzutage zählen nur noch gut 100.000 Menschen zu den Parsen, von Iran bis Indien. Im Gegensatz zu den ebenfalls in uralten Zeiten liegenden Anfängen des indischen Hinduismus trat hier jedoch der Monotheismus in den Vordergrund - und der Kampf zwischen Gut und Böse. Geister werden ebenfalls im »Religionswandel unserer Zeit im Spiegel der Religionswissenschaft«, herausgegeben in den 1970er Jahren von Gunther Stephenson, dargestellt: Ahnenkult, Spiritismus, Medien und Schwarze und Weiße Magie spielen eine Rolle im Leben der einheimischen Bevölkerung, beispielsweise in Brasilien. So schilderte Ernst Benz eine Szene: »Was sich hier abspielte, war ein allgemeiner Gemeindegottesdienst mit Heilzwecken, der ... dem einzelnen Gemeindemitglied Gelegenheit gab, sich sozusagen auf spiritistischem Weg von schädlichen Krankheitskräften entschlacken zu lassen.« Er beobachtete, dass in Brasilien Spiritismus und afrikanische Einflüsse, Geisterbeschwörungen und -heilungen herrschen. Es ist also auch hier von mehreren Geistern die Rede, und stets finden wir die zwei Pole, gut und böse, oder positiv und negativ.
»Das Wesen des Guten ist: Leben erhalten, Leben fördern, Leben auf seinen höchsten Wert bringen. Das Wesen des Bösen ist: Leben vernichten, Leben schädigen, Leben in seiner Entwicklung hemmen«, schreibt Albert Schweitzer. Jedoch, wie konnte ein Böses überhaupt entstehen, wenn Gott doch »gut« ist? Oder ist die ganze Angelegenheit so aufzufassen, wie im Film »Die rechte und die linke Hand des Teufels«, in dem Bud Spencer und Terence Hill als böse Buben die Armen und Schwachen beschützen und also doch eigentlich die Guten sind?
Читать дальше