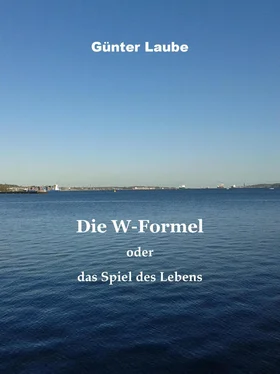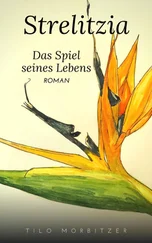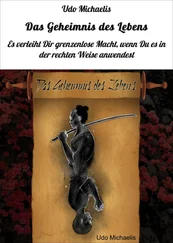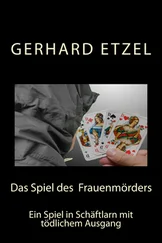Was nützt Religion? Gestaltet sie das Leben erträglicher?
Die Lehren der beiden Weisen werden im heutigen China »zu einer praktischen Religion vermengt« ( stern ), und das Streben nach Harmonie ist ein signifikanter Bestandteil dieser Religion. Das Symbol des Kreises mit einer geschwungenen schwarzen und einer weißen Seite und je einem kleinen Kreis in der Mitte in der jeweils anderen Farbe zeigt, dass nichts ohne sein Gegenteil bestehen kann. Yin und Yang, weiblich und männlich, passiv und aktiv, gelten als die Grundprinzipien des Kosmos.
Aha! Endlich wieder einmal Prinzipien, die sich (auch) in der Natur finden - und somit in der Physik. Aus der Schule kennen wir noch das Plus und Minus in der Elektrizität oder im Magnetismus, und in der Natur, ganz klar, männlich und weiblich. Ein Paradies oder eine Hölle werden in dieser Lehre allerdings nicht erwähnt, hingegen existiert ein Herr des Himmels, der jedoch »in das Geschehen auf Erden nicht eingreift« ( stern ), sowie »Geister ohne spezifische Gestalt«. Schade, da hatten wir mal zwei Prinzipien, die wirklich nachvollziehbar sind, und dann wieder ein nicht fassbarer Gottes- und Geisterbegriff.
Doch bleiben wir in der Praxis, im heutigen Leben: Zweieinhalb Jahrtausende später scheinen einige Menschen anderen die Hölle auf Erden bereitet zu haben: Anfang der 1930er Jahre, zur Zeit der japanischen Invasion in der Mandschurei, wurde in China eine Frau geboren, die viele Höhen und Tiefen, die das Leben in diesem großen Land in den folgenden Jahrzehnten bereit hielt, erlebt hat. Eine ihrer Töchter, Jung Chang, wurde 1952 geboren und wanderte später nach England aus. 1988 besuchte Jung Changs Mutter sie ihn London, und sie erzählte ihr die Geschichte ihres Lebens - und die von ihrer Mutter. So wurde der Grundstock für »Wilde Schwäne« gelegt - eine Biografie von drei Generationen im China des 20. Jahrhunderts. Geprägt von Invasionen, Revolutionen, Tyrannei, Folter, Mord, Totalitarismus - und bitteren Liebesgeschichten.
»Um ihre Herrschaft zu rechtfertigen, hat die Partei eine offizielle Version der Geschichte vorgeschrieben, aber »Wilde Schwäne« entspricht nicht dieser Linie«, schreibt Jung Chang. »Die derzeitige Führung hält immer noch am Mythos Mao fest - weil sie sich als seine Erbin versteht und ihre Legitimität über ihn beansprucht.« Daher ist »Wilde Schwäne« in China verboten, denn »die Partei kommt dabei nicht gut weg.«
Wie die Partei die Bevölkerung drangsalierte, erläutert Jung Chang an Beispielen wie diesem: »Durch die sogenannte »Gedankenreform« wollte die Partei noch in die letzten Ritzen des Privatlebens eindringen.« Die künstliche Erzeugung von Schuldgefühlen, die Zerstörung der Freizeit und des Privatlebens sowie Kontrolle desselben gehörten zu den Instrumenten, um die Herrschaft über die Masse zu erlangen und zu behalten. »Intellektuelle Unwissenheit wurde als große Errungenschaft gefeiert«. Diese Gehirnwäsche zeigte Wirkung, die Partei war die dominierende Kraft, die herrschende Macht. Hierarchien wurden bis ins kleinste Detail ausgearbeitet, um auch dem kleinsten Glied in der Kette das Gefühl von einer wie auch immer gearteten Wichtigkeit zu suggerieren. Das Denken war nachhaltig vergiftet, die Menschen vernachlässigten das alltägliche wahre Leben völlig. So entkam Jung Changs Mutter nur knapp dem Tod, als sie ihre erste Fehlgeburt hatte, und wollte sich von ihrem Mann scheiden lassen. Doch »er versprach, in Zukunft mehr Rücksicht auf sie zu nehmen, und sagte, daß er sie liebe und sich bessern wolle«.
Unausgesprochene Verbote herrschten unter den Kommunisten, das System war engmaschig, fast perfekt. Ihr Vater hatte dieses Prinzip derart verinnerlicht, dass es später zum Streit mit Jung Changs Großmutter kam und diese nach einem einmonatigen Besuch die beiden verlassen musste. Berücksichtigt man, dass sie dafür zwei Monate unterwegs war, zum Teil unter Lebensgefahr quer durch China, kann man es einordnen.
Die Szenen, die Jung Chang schildert, mahnen uns an eine Zeit, die in Deutschland noch gar nicht so lange zurück liegt, wir werden auf unserer Reise noch dorthin gelangen, in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Doch bleiben wir für den Moment im historischen Kontext, gar nicht weit von unserer momentanen Station lebte Buddha, und das quasi zeitgleich. Lassen Sie uns also einen kleinen Abstecher machen. Es geht gen Süden, wieder nach Indien, und diesmal in einen Königspalast.
II.5. Der I-Faktor
Der Begriff »Buddha« stammt aus dem Sanskrit und bedeutet »Der Erleuchtete«. Dieser Ehrentitel wurde dem 560 vor Christus geborenen Siddharta Gautama verliehen, der im Alter von 29 Jahren seine Heimat unweit des Himalaya verließ und nun außerhalb des Palastes, in dem er aufgewachsen war, den Begriffen Alter, Krankheit und Tod begegnete. Durch Meditation unter einem Feigenbaum gelangte er zur Erleuchtung, um anschließend einen Mönchsorden zu gründen, dem später ein Nonnenorden folgte. Die nach ihm benannte Lehre des Buddhismus ist die nächste Weltreligion auf unserer Reise, und allein schon auf Grund des geographischen Bezugs besteht eine Wesensverwandschaft zum Hinduismus. So ist auch hier die Rede von »Karma«, dem Gesetz von Ursache und Wirkung, dem alle Geschöpfe des Universums unterliegen. Alle guten und bösen Taten ziehen Wirkungen nach sich, die neue Ursachen schaffen und die es in einem späteren Leben zu erfüllen gilt. So »herrscht im Kosmos ein dauerndes Geborenwerden und Sterben« (Brockhaus). Dieser Kreislauf endet erst dann, wenn das gesamte Karma ausgeglichen ist.
Doch zurück zu dem Begründer, zu Gautama Buddha: Prinz Siddharta, der der Legende zufolge nach seiner Geburt bereits laufen und sprechen konnte, wuchs in einem Palast auf, abgeschnitten von der Außenwelt.
Aha, eine Legende! Oder doch ein Märchen? Oder ist die Sache mit dem Laufen und Sprechen symbolisch auszulegen? Die Geschichte scheint mit ein wenig orientalischer Färbung versehen zu sein, doch hören wir weiter zu: Als Sohn des Königs Suddhodana genoss der Prinz die angenehmen Seiten des Lebens und gewisse Privilegien, so studierte er altindische Schriften, die Veden. Doch wie gesagt, eines Tages begab er sich nach außerhalb des Palastes und lernte das Leben kennen. Alter, Krankheit und Tod. Darauf wurde er ein Wanderer, ein Bettelmönch. Unter einem Feigenbaum, auch als Bodhibaum bezeichnet, meditierte er und gelangte zur Erleuchtung. Von da an predigte er im Norden Indiens und im heutigen Nepal bis zu seinem Tod im Jahre 480 vor Christus. Je nach Quelle gibt es heute auf der Erde zwischen 360 und 450 Millionen Buddhisten. Seine Prinzipien basieren auf der Lehre der Wiedergeburt, der Reinkarnation, dem »Rad des Lebens«. Er lehrte die Menschen, wie sie sich aus diesem Kreislauf lösen und ins Nirwana eingehen können. Hierzu dienten Übungen, die bei den Menschen die Weisheit, die Moral und die geistige Disziplin ausbilden sollten. So wären höhere Bewusstseinszustände zu erreichen, und schließlich müsste man nicht mehr wiedergeboren werden, genau wie Buddha, der bei seiner Geburt sagte, das sei seine letzte Inkarnation.
Dieser Vorgang ist als Abschluss einer langen Reihe von Verkörperungen auf der Erde zu verstehen, den im Prinzip alle Menschen durchlaufen. Je höhere Bewusstseinsstufen sie erlangen, je reifer sie werden, umso größer ist das Verständnis für die Welt und eröffnet eine neue und andere Sichtweise auf dieselbe. In der buddhistischen Weltanschauung gibt es die Lehre von den Bodhisattvas, Wesen, die nach dem spirituellen Erwachen, der Erleuchtung, streben und letzten Endes ein Buddha, ein Erleuchteter, werden. Zu den Eigenschaften, die sie auf ihrem Weg entwickeln müssen, zählen Freigebigkeit, Sittlichkeit, Geduld und Weisheit, man kann sie als Vorbilder ansehen, von ihnen gehen Impulse für die menschliche Entwicklung aus. Wie auch Buddha einst ein Bodhisattva war, so soll der Überlieferung zufolge in der Zukunft wieder ein Bodhisattva auf der Erde leben und die Buddha-Reife erlangen. »Maitreya wird sich einst auf Erden inkarnieren, um den Dharma in seiner ursprünglichen Form wiederherzustellen und den Menschen neu zu verkünden«, schreibt Thomas Schweer in »Basis Wissen Buddhismus«. Es bleibt jedoch einiges offen, denn »obwohl er das Vorhandensein von Göttern und anderen überweltlichen Wesen nie leugnete, hielt er eine Beschäftigung mit diesen Fragen für unwesentlich«. Insofern kommt der Buddhismus ohne Schöpfungsbericht, ohne Seele und ohne Gott aus, dafür unterliegt alles der permanenten Veränderung oder Entwicklung, Begierden und Leidenschaften sind Ursache unseres Leids. Die endgültige Erlösung davon bietet das Nirwana. Es herrscht Toleranz gegenüber anderen Religionen, und dem Buddhismus werden Verbindungen zum Taoismus beigelegt. Für die Buddhisten, deren Großteil im fernen Asien, in China, Japan, Thailand, Vietnam und Myanmar lebt, sicherlich eine gute Sache. Aber was ist mit den sechseinhalb Milliarden anderen Menschen? Gelten die Prinzipien des Buddhismus für jeden Buddhisten? Oder für jeden Menschen? Muss man Buddhist werden, um ins Nirwana eingehen zu können? Und was ist mit den Göttern des Hinduismus, spielen die wirklich keine Rolle? Was ist mit dem Gott der Juden, mit den Ansichten der Naturvölker? Was hat es allgemein mit den Geistern und Göttern auf sich, von denen in anderen Religionen die Rede ist? Und inwiefern sind die Legenden und Erzählungen symbolisch oder wörtlich auszulegen? Und wie ist nun alles entstanden? Das Universum? Die Erde? Der Mensch?
Читать дальше