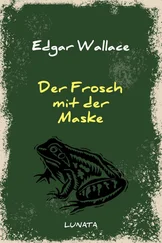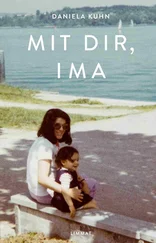Peter ist Weber von Beruf und nur ein paar Jahre älter als ich. Er will, sobald er ein Haus und einen Stall hat, Schafe aus England in die Kolonien bringen. »Du wirst sehen Priscilla, wir werden die beste Wolle aus ihren Fellen machen, und wunderbar weiche Stoffe daraus weben«, vertraut er mir an. Seine braunen Augen zwinkern mir lebhaft zu. Ich mag ihn sofort.
Wir haben noch immer eine Menge Gepäck, es sind unsere persönlichen Sachen, die wir während der Reise brauchen und Peter hilft uns, sie im Wagen zu verstauen.
Als der Wagen losfährt, schaue ich mich noch einmal um. Ich muss blinzeln, damit ich nicht weine, als ich das letzte Mal das Haus sehe, in dem ich aufgewachsen bin.
Meine Mutter stupst mich in die Seite und sieht mich vorwurfsvoll an. Sie hat kein Verständnis für Rührseligkeiten und findet sie unangebracht.
Ich schlucke, hole tief Luft und wende meinen Blick nach vorne. Ich bin 17 Jahre alt, als ich im Juli 1620 England verlasse.
Wir kommen in strömenden Regen in London an. Bis wir unsere Habseligkeiten vom Wagen geladen haben, sind wir bis auf die Haut durchnässt. Mein Vater hat zwei Zimmer in einem Gasthof gemietet, wo wir bis zur Abreise bleiben können. Er teilt sich eines davon mit Joseph, Peter und Robert. Ich bekomme mit meiner Mutter das andere Zimmer. Es ist nicht beheizt und von den Wänden läuft Wasser. Die Strohsäcke, auf denen wir schlafen, schimmeln.
Das Zimmer ist vollgeräumt mit unserer Habe für den täglichen Gebrauch.
Meine Mutter besteht darauf, die kleine Holzkiste mitzunehmen, in der sie ihre getrockneten Kräuter und Wurzeln aufbewahrt und der stets ein eigentümlicher Geruch entströmt.
»Sie werden dich noch bevor wir ablegen wegen Hexerei verhaften«, wettert mein Vater aufgebracht, als er die Kiste bemerkt.
Doch meine Mutter hält sie eigensinnig umklammert. »Ich gehe nicht, ohne meine Arzneien«, erklärt sie bestimmt und mein Vater gibt zähneknirschend nach. Meine Mutter kennt sich gut aus mit Heilmitteln und meinem Vater ist nicht ganz wohl dabei. Wir haben viele Frauen brennen gesehen, die wegen solcher Künste verurteilt wurden.
Wir ziehen uns trockene Sachen an und gehen nach unten in den Gastraum. Es gibt Hammeleintopf, der einen starken Beigeschmack hat. Meine Mutter rümpft die Nase: »Das Fleisch ist verdorben.« Ich kann nur wenige Bissen davon essen.
Am nächsten Morgen scheint die Sonne und es ist herrlich warm. In aller Frühe begleiten wir, meinen Vater zum Dock. Er will uns die Mayflower zeigen, das Segelschiff, das uns in die neue Heimat bringt.
Unser Frachtgut ist bereits an Bord. Mein Vater hat über 100 Paar Schuhe und ein Dutzend Stiefel mitgebracht. Dazu zahlreiche Möbel, Truhen, gepolsterte Sessel und Kisten voller Wäsche, Werkzeuge, Säcke voller Saatgut und noch etliches mehr. Unsere Tiere, die Ziegen, Schweine und Hühner und natürlich Peters große Hündin Birdie, kommen auch noch mit.
Die Mayflower ist ein großes, wuchtiges Segelschiff, mit einem schnabelartigen Vorderteil, und hohen Aufbauten an Heck und Bug. Ich zähle drei gewaltige Masten verteilt auf dem Deck und einen kleineren hinten am Heck, an denen die Segel jetzt eingeholt und festgezurrt sind. Sie werden sich wohl mächtig bauschen, sobald sie gehisst sind und der Wind sich in ihnen fängt.
Obwohl das Schiff beeindruckend ist, bin ich ein wenig enttäuscht. Die Mayflower wirkt alt und abgenutzt.
Peter sieht meinen skeptischen Blick. »Was ist los?«, fragt er mich.
»Ich finde, das Schiff, sieht ein wenig schäbig aus«, flüstere ich ihm zu.
Er lacht. »Lass dich nicht vom bescheidenen Aussehen der Mayflower täuschen. Sie ist sehr zuverlässig und hat sich auf vielen Reisen kreuz und quer über die Meere, bestens bewährt«, erklärt er mir.
Ein kräftiger blonder Mann, mit wettergegerbtem Gesicht, der ungefähr im Alter meines Vaters ist, begrüßt uns freundlich. Er stellt sich als Christopher Jones vor und ist einer der vier Eigentümer des Schiffes und Kapitän der Mayflower. Die Merchant Company hat ihn mit Schiff und Besatzung für die Reise angeheuert.
»Meine Mayflower ist ein gutes Mädchen. Wir haben eben eine Ladung von 180 Fässern besten Weines aus Portugal hergebracht. Meine Süße lag 12 Fuß tief im Wasser und sie war dennoch pfeilschnell«, erzählt Mr. Jones stolz.
Wir dürfen an Bord gehen und er zeigt uns die Decks.
»Kapitän Jones, wo werden wir schlafen?«, fragt meine Mutter. Es ist eine typisch weibliche Frage und die Männer tauschen nachsichtige Blicke.
Kapitän Jones führt uns auf das Zwischendeck, wo auch die Kanonen verstaut sind. Ich sehe fast ein Dutzend massiger Artilleriegeschütze, und mein Vater weist eitel darauf hin, dass vier davon unserer Company gehören und uns in der Neuen Welt zur Verfügung stehen werden.
»Hier Madam, wird euer Schlafplatz sein«, erklärt Kapitän Jones und meine Mutter und ich schauen ihn erschrocken an. Schon jetzt ist es sehr beengt dort, obwohl noch keine Passagiere an Bord sind. Die Männer stehen in leicht gebückter Haltung und wäre ich nicht so klein, würde auch ich nicht aufrecht stehen können. Die Luft riecht muffig und dringt nur durch eine schmale Luke herein, die auf das Oberdeck führt. Dorthin gelangt man über eine wackelige Strickleiter.
Ich frage mich, wie wir hier zwei Monate leben sollen, wage aber nicht mich laut zu äußern. Meine Mutter atmet tief durch und presst die Lippen aufeinander, aber sie sagt kein Wort dazu.
»In zwei Tagen brechen wir auf«, erklärt Kapitän Jones.
Wir verlassen das Schiff und gehen zu dem Gasthof zurück. Dort kommt eben die Familie Martin an. Mr. Martin hat noch mehr Gepäck dabei als wir. Seine Frau Mary ist wortkarg, in ihren Augen liegt der gleiche überhebliche Ausdruck, wie bei ihrem Mann. Sie haben Mrs. Martins Sohn aus erster Ehe, Solomon Prower und einen Diener, John Longmore, bei sich, die beide im Alter meines Cousins Peter Browne sind.
Es schickt sich nicht für mich, mit ihnen zu reden, und so unterhalten sich die Männer eine Weile, während wir Frauen daneben stehen und zuhören. Peter verliert jedoch bald die Lust an den Gesprächen und macht einen Spaziergang mit seiner Mastiff-Hündin. Ich denke, dass auch er nicht sehr angetan ist von der Familie Martin.
Mein Vater hört sich geduldig die wortreichen Klagen von Mr. Martin über Robert Cushman, den Agenten der Leidener Gruppe, an.
»Dieser armselige, betende Wicht, der von Geschäften keine Ahnung hat, wagt es tatsächlich, von mir Rechenschaft wegen der Buchführung zu verlangen! Angeblich vermisst er eine Spende von 700 Pfund in den Aufzeichnungen der Gesellschaft und nun will er von mir wissen, wo das Geld geblieben ist«, beschwert er sich empört.
Читать дальше