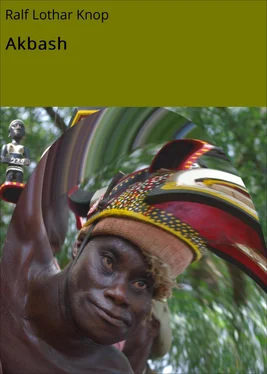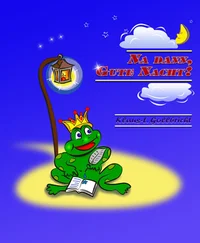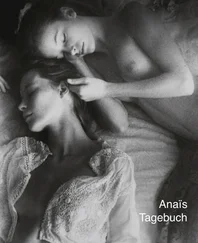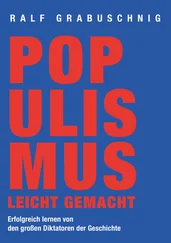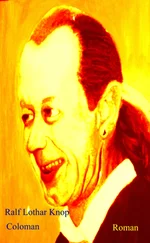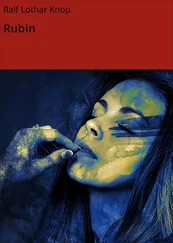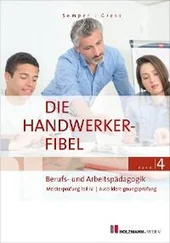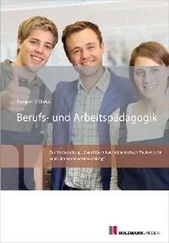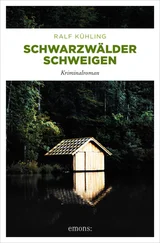Radulf wollte etwas Neues schaffen, etwas, das den Menschen keinerlei Vorschriften machte und ihnen keine Bedingungen stellte, wie das in allen Religionen der Fall war; nur wenn man ganz bestimmte Bedingungen erfüllte, nur wenn man exakt das glaubte, was einige wenige Männer festgelegt hatten, durfte man zu der jeweiligen Gemeinschaft gehören. Das war ein weiterer wichtiger Punkt, in allen Religionen waren es Männer, die über alles bestimmten, in allen Religionen waren die Frauen Wesen zweiter Klasse, im Judentum und im Islam waren sie beim Gebet sogar räumlich voneinander getrennt.
Im Islam glaubten die Männer, über die Frauen bestimmen zu können und gleichzeitig waren sie doch so schwach und ängstlich, dass sie ihre Frauen verhüllten, damit ihre Reize nicht von anderen Männern gesehen wurden. Sie vertrauen also weder anderen Männern noch ihren eigenen Frauen, die sie als persönlichen Besitz betrachten, über den sie wie über ein Objekt verfügen können. Nur aus dieser angemaßten Vormachtstellung gewinnen sie ihr Selbstbewusstsein, doch mit Selbstsicherheit hatte das überhaupt nichts zu tun, im Gegenteil, ihre Sicherheit war ständig bedroht.
Aber auch im Christentum sind die Frauen nicht mit den Männern gleichberechtigt. „Die Frau schweige in der Gemeinde“ heißt es da in ihrem heiligen Buch und sie „sollen sich unterordnen“ und „wenn sie etwas wissen wollen, sollen sie zu Hause ihren Ehemann fragen“. Auch hier ist es ausschließlich der Mann, der über alles bestimmen kann und dem sich die Frau unterzuordnen hat. In dieser Frage gab es also so gut wie keinen Unterschied zwischen den Religionen.
Gleichzeitig spielte angeblich die Liebe eine große Rolle in diesen Religionen, aber was war denn das für eine Liebe? In dem Verhältnis zwischen Mann und Frau ging es doch wohl eher um Befehl und Gehorsam, wie beim Militär. Liebe kann ja niemals in einem solchen Verhältnis gedeihen, zur Liebe gehört jedenfalls wesentlich mehr. Da fand Radulf seine Vorstellungen doch eher bei einem so sensitiven Geist wie Heinrich von Kleist:
Vertrauen und Achtung, das sind die beiden unzertrennlichen Grundpfeiler der Liebe, ohne welche sie nicht bestehen kann, denn ohne Achtung hat die Liebe keinen Wert und ohne Vertrauen keine Freude.
Doch so sensitive Geister wie Heinrich von Kleist finden keine Anerkennung in der Gesellschaft, selbst Goethe äußerte Verwunderung und Unverständnis über Penthesilea, eines von Kleists großen Werken. Durch das Unverständnis, das mit dem Aufführungsverbot eines anderen Werkes, Prinz Friedrich von Homburg, verbunden ist, fühlt Kleist sich so „wund“, dass erste Suizidgedanken in ihm auftauchen. Mit gerade einmal vierunddreißig Jahren teilt Heinrich von Kleist dann seiner Schwester mit, dass ihm „auf Erden nicht zu helfen war“ und dass er mit „Freude“ und „Heiterkeit“ in den Tod geht, begleitet von Henriette Vogel, deren Körper von einem Karzinom so zerfressen ist wie die Seele von Heinrich von Kleist.
Doch Radulf wollte es nicht wahr haben, dass Liebe erst im Tod möglich sein sollte, nein, er war fest davon überzeugt, dass die Menschen zu Liebe, Vertrauen und Achtung fähig waren. Der erste Schritt auf diesem Weg musste seiner Meinung nach darin bestehen, dass die Menschen aufhörten, sich gegenseitig Vorschriften zu machen. Doch wie konnte das erreicht werden?
Radulf war der Überzeugung, dass die Angst der Grund für dieses unwürdige Verhalten der Menschen sei, zunächst einmal die Angst, eigene Wünsche und Bedürfnisse bedingungslos zu verwirklichen, und um sich das selbst nicht eingestehen zu müssen, hatten die Menschen so scheinheilige Begründungen wie: das tut man nicht, wenn das jeder machen wollte, das ist verboten, das ist Sünde. Dann stellten sie aber fest, dass andere Menschen durchaus ihre Bedürfnisse befriedigten, Bedürfnisse, die sie ja selbst auch hatten, aber nicht trauten sie zu denken, sie auszusprechen, geschweige denn zu verwirklichen. Wenn sie selbst es nicht durften, dann sollten es aber bitte schön auch die anderen nicht dürfen, das ist schließlich nur gerecht.
Auf diese Weise entsteht die nächste Angst, nämlich die Angst, zu kurz zu kommen, im Mangel zu leben, also ein mangelhaftes Leben zu führen. Diese Angst ist so unerträglich, dass die Menschen im öffentlichen und im privaten Raum einen riesigen Katalog von moralischen und ethischen Vorschriften schaffen und damit diese Vorschriften auch eingehalten werden, ergänzen sie diesen Katalog gleich noch durch einen zweiten, der für die Nichteinhaltung einer Vorschrift auch gleich entsprechende Strafen und Sanktionen enthält.
Die Menschen verfehlen ihren Weg nach Glück und Liebe, indem sie sich selbst Vorschriften machen, die diesen Weg versperren und statt zu erkennen, dass ihr Unglück von ihnen selbst verursacht wird, suchen sie die Ursachen in Äußerlichkeiten, die sie nicht beeinflussen können. Es sind immer andere Menschen und fremde Dinge, die scheinbar ihr Unglück verursachen. Dabei ist die Lösung doch so einfach.
Das Zauberwort heißt „Zufriedenheit“. Zufriedenheit ist vollkommen unabhängig von anderen Menschen und Dingen, also absolut unabhängig von Äußerlichkeiten. Zufriedenheit ist eine innere Einstellung zum Leben, die besagt, ich bin ein liebenswerter Mensch, ich bin berechtigt, ich bin ein guter Mensch, ohne mich würde die Welt im Mangel leben, sie wäre mangelhaft.
Wenn die Menschen auf diese Weise mit sich selbst zufrieden sind, dann brauchen sie auch nicht mehr die anderen Menschen zu fürchten; sie sehen vielmehr einen Spiegel im anderen Menschen, der ihnen zeigt, was ihnen auf ihrem Weg zu Glück und Liebe noch fehlt, dann können sie miteinander wetteifern, aber nicht mehr als Konkurrenten, sondern als Partner, die sich gegenseitig bereichern.
Du willst für deine Liebe ja nichts als wieder Lieb‘ allein;
und Liebe, dankerfüllte Liebe soll meines Lebens Wonne sein, soll meines Lebens Wonne sein.
Zufriedenheit mit sich und dem eigenen Leben führen zu Liebe, Vertrauen und Achtung, bedingungsloser Liebe, die den Anderen nicht kritisiert und vor allem ihn nicht verändern will, die den Anderen genauso bedingungslos akzeptiert wie sich selbst. Aber viele Menschen, davon war Radulf überzeugt, übersahen in ihrer Verliebtheit am Anfang einer Beziehung die Eigenschaften des Partners, die ihnen nicht gefielen oder, was noch schlimmer war, sie glaubten, der Andere würde sich noch verändern, wenn er erst einmal mit ihnen zusammen lebt. Und dann veränderte der andere Mensch sich tatsächlich, aber nicht so wie sie es gewünscht hätten, sondern es wurde ihrer Ansicht nach noch schlimmer, so schlimm, dass sie sich schließlich scheiden ließen, nur um sich einem neuen Partner zuzuwenden, bei dem sie nach einiger Zeit feststellten, dass er ja auch schon wieder nicht so war, wie sie es wünschten. Sie waren einfach nicht in der Lage zu erkennen, dass nicht der Andere, sondern sie selbst das Problem waren.
Radulf wusste natürlich, warum gerade jetzt ihn solche Gedanken so intensiv beschäftigten, seine Erlebnisse in Mali hatten einen so nachhaltigen Eindruck auf ihn gemacht, dass er versuchte, sie irgendwie in sein Leben einzuordnen. Vor allem beschäftigte er sich gedanklich immer wieder mit Aayana. Es war ganz ohne Frage eine wunderbare Zeit mit ihr gewesen, aber er wusste eben nicht, ob man eine solche Beziehung genauso wie eine Reise einfach beenden konnte. Er würde ganz sicher nicht mehr nach Mali reisen, aber er fragte sich, warum Aayana sich so über den Zettel mit seiner Anschrift gefreut hatte, denn er wusste ja, dass sie aus finanziellen Gründen auf keinen Fall in der Lage war, nach Deutschland zu kommen. Es konnte also eigentlich nur bedeuten, dass sie brieflichen Kontakt mit Radulf halten wollte, in der Hoffnung, dass er noch einmal nach Mali kommen würde.
Читать дальше