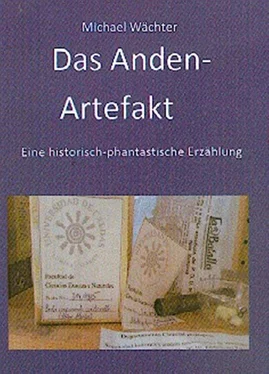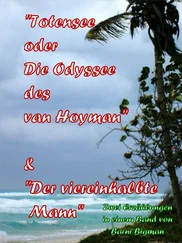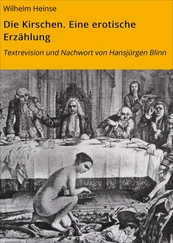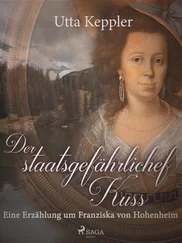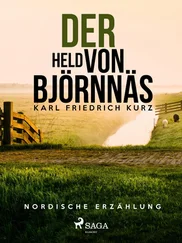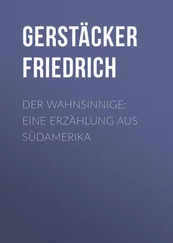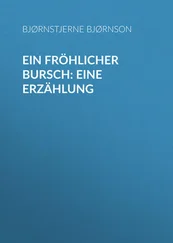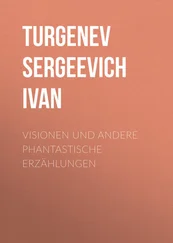„Ja, da ist so entsetzlich viel Schlimmes passiert im Krieg“ sagte Mutter und senkte den Blick. „Aber das haben wir nicht alles gewusst.“.
Ich entschloss mich, Nachforschungen anzustellen. Ich wollte wissen, wer meine Vorfahren waren und was sie so erlebt haben. Ich legte einen Aktenordner an – mein genealogisches Archiv. Mutter gab mir einen Stammbaum, einen „Ariernachweis“. Da waren in Sytterlinschrift die Geburts-, Hochzeits- und Strebedaten meiner Groß-, Ur- und Ururgroßeltern verzeichnet, und ein amtlicher Stempel. Ich bekam von Vater eine Rolle Pausch- oder Pergamentpapier, nahm meinen Schulfüller und malte alle Daten nach. Ich fragte mich, ob das wohl ein „Ariernachweis“ war, den Opa Willi gebraucht hatte – oder ob er von der Hochzeit meiner Eltern war. Sie hatten in Bayern geheiratet, in einer Kapelle St. Bartholomä am Königssee. Mutter war evangelisch und Vater katholisch, und ihre Eltern waren gegen die Heirat gewesen, weil sie konfessionsübergreifend war. Also hatten meine Eltern heimlich geheiratet und kamen aus dem Urlaub als Ehepaar wieder. Da muss Opa Benno wohl richtig geschimpft haben, aber dann wurde es doch akzeptiert.
In den folgenden Wochen schrieb ich an Kirchämter, deren Adressen ich in Telefonbüchern aus Telefonzellen finden konnte – und im Postamt an der Josefskirche und am Bahnhof. Ich wählte einfach die Orte aus, an denen die Vorfahren gelebt hatten, deren Eltern nicht mehr in diesem Stammbaum verzeichnet waren. Ich schrieb, ich betreibe Stammbaumforschung und bat um Auszüge aus Tauf- und Sterberegistern. Ab 1871 ging alles über die Standesämter, aber für die Zeit davor waren Kirchen die Informationsquellen. Ich fand zum Beispiel einen Hinweis auf Geburtsdaten von Vorfahren in Leer und Weener schrieb die dortigen Kirchenämter an. Ein Pastor Ringena aus Ostfriesland schrieb mir ein paar Tage später zurück. Er schickte mir ein paar Auszüge und wünschte mir, ich möge in Jesus bleiben und fest im Glauben. Später bekam ich sogar einen Brief aus der DDR. Er kam von einem Pastor, der mir Tauf- und Heiratsregisterauszüge abgetippt und beurkundet hatte – von einem „Strumpfwarenfabrikant allhier“ aus Senftenberg oder Hoyerswerda. Als Dankeschön bat er um ein Päckchen mit Kaffee, das ich in die DDR schicken sollte. Ich verstand erst nicht, warum er Kaffee zugeschickt bekommen wollte, aber Mutter erklärte mir, dass es in der Ostzone keinen Kaffee zu kaufen gab. Dein Vater ist Büromaschinenmechanikermeister. Der ist immer zur Leipziger Messe gefahren, über die Transitstrecken. In den Intershops waren sie ganz wild auf unser Westgeld. Sie habe auch selbst einmal ihre Bekannten in Karl-Marx-Stadt besucht. Die gehörten zu den Zeugen Jehovas und wurden in der DDR verfolgt.
So wie davor auch im 3. Reich , dachte ich. Ob Mutter sie deshalb wohl unterstützt und ihnen Lebensmittelpakete schickt und dafür DDR-Briefmarken zurückgeschickt bekommt, die sie in diesen Briefmarkenalben sammelt?
Mutter erzählte weiter, sie habe ihren Bekannten einmal Bananen und Orangen mitgebracht, weil es sie dort ebenso wenig zu kaufen gebe wie Kaffee. Dort seien ja immer nur leere Regale in den Läden in Karl-Marx-Stadt, und lange Schlangen davor. Man kaufe dann eben, was es gerade dort gebe. Und später tausche man es ein gegen das, was man gerade brauche.
„Und stell dir vor“, sagte sie, „die haben dann in die Bananen und Apfelsinen einfach so reingebissen. Die haben gar nicht gewusst, dass man sie erst schälen muss!“
Was ich nicht wusste war, dass die Stasi die Post öffnen ließ. Sie wusste von Mutters Tauschhandel, und nun auch von meiner Informationssuche und den Kontakten zur Kirche. Ich geriet in ihr Visier – es reichte ihren informellen Mitarbeitern und Bürospitzeln aus, für einen Anfangsverdacht wegen Spionage und Kontaktes zu oppositionellen Gruppen. Schließlich hatte es wohl Kirchenleute östlich vom Harz gegeben, die Ausreisewilligen zur Flucht über die Grenze verholfen hatten.
Der Schwarm aus Flugkörpern, die der Lichtblitz beschleunigt hatte, verließ das Sternsystem, aus dem er gekommen war. Die geheimnisvollen Flugkörper rollten ihre Sonnensegel wieder ein und fuhren sie in ihr Inneres. Sie verschlossen ihre Öffnungen. Jetzt sahen sie aus wie Tetraeder – regelmäßige Körper mit Flächen aus gleichseitigen Dreiecken. Andere hatten die Form von Hexaedern, regelmäßigen Körpern mit sechs Dreiecksflächen mit neun Kanten und fünf Ecken. Wieder andere waren oktaedrisch und hatten acht Flächen und drei Ecken. Die größten Einheiten des Schwarms glichen Kugeln, deren metallische Oberflächen teilweise auch Fünf- und Sechsecke aufwiesen – Strukturen, die den fußballförmigen Molekülen einer besonderen Art von Kohlenstoff-Molekülen ähnelten. All diese fremden Körper passierten einen weißen Zwergstern. Seine Raumkrümmung vervielfachte ihre Geschwindigkeit. Dann schaltete der fremdartige Schwarm seine Mikrocluster voll künstlicher Superintelligenzen aus, in eine Art Schlafmodus. Und die Flugkörper gleiteten durch das tiefkalte, pechschwarze All. Ihr Schwarm war auf Kurs.
Kapitel 5: Die Eiskapelle
Ich wurde ein richtiger Stammbaum-Forscher. Über meine genealogischen Nachforschungen fand ich eines Tages heraus, dass ich eigentlich gar nicht Jens Jedermann hätte heißen dürfen. Ich bekam nämlich eine Urkunde zugeschickt, die mir ein Pfarrer abgetippt hatte. Mein Ururururgroßvater väterlicherseits, so hieß es, geboren im Jahr 1782, hieß nämlich damals eigentlich Gerhard Henricus Dölken. Er war der Sohn von „Colonus“ (Bauer) Joan Bernard Dölken. In Laer hieß er später Bauer Große-Jedermann, denn er heiratet 17.3.1820 unter dem Namen Große-Jedermann die katholische Witwe und Bäuerin Anna Maria Große-Jedermann, eine geborene Lütke-Ausber aus Füchtorf. Das fand ich spannend. Früher ging sonst immer der Familienname des Mannes auf die Familie über – und selten der der Frau (Mein Ururururgroßvater mütterlicherseit hingegen war der 1792 geborene, evangelische Andreas Friedrich Güntgen, Maurer zu Sachsa im Harz).
Mein Vater war Büromaschinenmechaniker und –händler. Mein Großvater auch. Opa Benno musste deshalb nicht noch einmal im Zweiten Weltkrieg kämpfen. Die Büromaschinenfabrikation galt als kriegswichtige oder kriegsentscheidende Industrie. Opa und Oma hatten ihre Kinder deshalb mit der „Kinderlandverschickung“ in Sicherheit gebracht. Sie wurden zur KLV nach Bayern geschickt, in die Gegend von Berchtesgaden am Königssee. Oma erzählte, die „Reichsdienststelle KLV“ hatte bis Kriegsende über 2000000 Kinder evakuiert, um sie vor dem Luftkrieg in Sicherheit zu bringen. Die KLV-Lager waren umstritten. Bischof Clemens August Graf von Galen hatte im Hirtenbrief gewettert, die Kinder in den Lagern seien dort ohne jede kirchlich-religiöse Betreuung – was die Nazis als „kirchliche Gegenpropaganda“ abtaten. Klar, sie wollten die Jugend ja auch umerziehen. Berchtesgaden – von diesem Ort hatte Vater mir erzählt. Die Geschichte war richtig spannend, fast gruselig. Erst viel, viel später begriff ich, was sie mit meiner Entdeckung zu tun hatte.
Als Kind war ich mit meinen Eltern dort am Königssee im Urlaub. Wir waren beim Watzmann. Und im Salzbergwerk Berchtesgaden. Wir fuhren mit der Grubenbahn in das Schaubergwerk. Ich bekam einen Helm auf und einen Regenmantel an – „gegen das Salzwasser“. Die Loren ratterten über die Schienen nach unten. In der Lore vor uns saß ein Einheimischer. Er erzählte den mitfahrenden Gästen von Auswärts die Geschichte vom Salzbergwerk. Er brüllte fast, denn er kam kaum gegen das Rattern an.
„Mir san hia in Berchtsgoan (amtli: Berchtesgaden). Des is a Moakt gonz im sidestlichstn Zipfi vo Obabayern, middn im Hochgbiag unn glei in da Näh vom Keenigssää unn vom Watzmo.“
Читать дальше