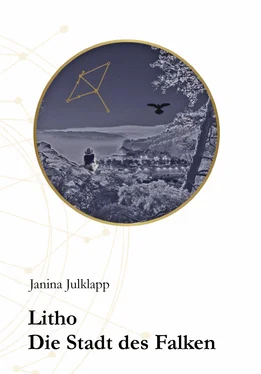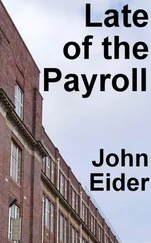„Mir wird übel werden“, dachte sie. „Was für ein vom Dogan verfluchter Schnaps.“
Sie ging langsam zum Flussufer. Hier, im Westen der Unterstadt, war der Fluss verseucht von allen denkbaren Abwässern. Die ekelhafte Brühe der Gerbereinen verdarb alles Leben im Fluss und er würde dampfend und dreckig in das viele Meilen entfernte Meer fließen. Zum ersten Mal fragte Frida sich, ob die Menschen, die noch westlicher am Meer lebten, sauberes Wasser bekommen konnten. Frida kannte nur Litho. Niemals hatte sie diese Stadt verlassen. Aber jetzt, wenn sie darüber nachdachte, wo ihre Mutter geboren sein mochte, wohin der Aphel floss oder wie ein Meer aussah, kam ihr die große Stadt Litho klein vor. Sie dachte an David im Heilerhaus und an Jon, der irgendwo hin verschleppt wurde, für etwas, das er nicht getan hatte und womit er nicht das Geringste zu tun hatte. Sie dachte an den jungen Leo und seine Bande, die nun ohne sie weiter gegen die Falkenauten kämpfen mussten. Litho, die verfluchte Stadt.
Frida ging langsam durch das Gestrüpp am Flussufer entlang, in die Richtung der flachen Gebäude der Gerbereien, gegen die Fließrichtung des Aphels.
Wer hatte David angegriffen und wieso? War es Zufall, wäre nichts passiert, wenn David nicht diesem Schrei gefolgt wäre?
Zufall gibt es nicht, dachte Frida. Die Dinge geschehen nur, wenn sie angestoßen wurden.
Wo waren die Leute von Adam Rothaar, als es passierte? Wenn Adam Rothaar so viel daran lag, dass sein Sohn in der Unterstadt beschützt und beschattet wurde, warum hatten die Leibwächter im entscheidenden Augenblick versagt? Und, vor allem, warum in Dogans Namen dachte sofort jeder, dass sie es gewesen wäre?
„Jon…“, Frida rieb sich die Augen. „Wo bist du? Verflucht noch mal!“
Sie war nicht mehr weit von den ersten Gebäuden entfernt. Sie konnte die in Eile hochgezogenen Mauern der Häuser erkennen, die wieder einzufallen drohten obwohl sie nicht alt sein mochten. Sie ähnelten ihren Besitzern, Männern, die in jungen Jahren grau geworden waren und an Vergiftungen und Verätzungen starben, bevor sie älter werden konnten.
Da geschah etwas Eigentümliches. Obwohl es ein heißer Tag war, fühlte Frida einen Schauer in ihrem Nacken. Ihr war, als hätte sie ihren Namen gehört, klar und so nah, als hätte ihn jemand in ihr Ohr geflüstert. Sie wandte sich um, niemand war zu sehen. Sie spürte nur den leichten Wind, der in ihren Haaren spielte. Erstaunt verharrte Frida unbeweglich. Mit einem Kopfschütteln befreite sie sich nach einigen Sekunden von dem Gefühl. Und als sie den Kopf zur Seite wandte, da sah sie jemanden oder etwas, das sich zitternd in den Zweigen zu ihrer Linken verborgen hatte. Sofort verkrampften sich alle Muskeln in Fridas Körper, die Hände ballten sich zu Fäusten, bereit zum Angriff. Doch der bebende Haufen rührte sich nicht. Frida trat lautlos einen Schritt näher. Zwischen Blättern, Brennnesseln und Unterholz zeichnete sich struppiges, graues Fell ab. Frida beugte sich hinunter und ein gedämpftes Heulen erklang. Da sah Frida, was dort lag: Ein kleiner Hund hatte sich zusammengekrümmt in dem Gestrüpp versteckt, die Schnauze unter einer Vorderpfote vergraben. Sein Fell war schmutzig, zerrupft und er war so dünn, dass Frida die Knochen unter dem Fell deutlich sah. Verkrustetes Blut klebte an einem Ohr und er hatte die Augen nur halb geöffnet.
„He du. Was ist denn mit dir?“
Frida erkannte ihre eigene Stimme nicht mehr. Die Worte kamen abgehackt und krächzend von ihren Lippen. Sie räusperte sich und versuchte es noch einmal, doch es wurde nicht besser. Vorsichtig streckte sie eine Hand aus und berührte den kleinen Hund am Rücken, bereit, sofort zurückzuweichen, wenn er nach ihr biss. Doch er reagierte kaum. Er zuckte nur leicht zusammen und sah sie durch die müden, milchig weißen Augen hindurch vorwurfsvoll an. Sanft streichelte sie über seinen Rücken. Der Kleine ließ die Zunge weit aus dem Mund hängen und atmete pfeifend. Kläglich klopfte der dünne Schwanz des Hundes auf ihre Berührung hin gegen einen Ast. Fridas Sicht verschwamm. Wütend fuhr sie mit ihrem Ärmel über die Augen. Wasser , dachte Frida, er braucht Wasser. Sonst verdurstet er.
Die Tonne neben der verfallenen Hütte fiel ihr ein. Dort würde sie ihn hinbringen, ihm Wasser geben, ihn im Schatten schlafen lassen. Behutsam griff sie unter den viel zu leichten Körper des Hundes und hob ihn an. Er war einfach zu tragen und Frida spürte das rasend klopfende Herz an ihrer Brust.
„Keine Angst“, murmelte sie mechanisch. „Es wird gleich besser.“ Den Hund an sich gepresst, ging Frida zurück zu der kleinen verfallenen Hütte.
Über den Steinbögen spannte sich eine helle und einschüchternde Decke von hundert Fuß Durchmesser. Vor vielen Jahren hatte ein namenloser Künstler unzählige Sterne darauf gemalt. Sie leuchteten golden vor cremeweißen Wolkenfetzen. Im Mittelpunkt des Kreises war ein großer Falke mit silbernem Gefieder, die langen filigranen Flügel ausgebreitet. Von hohen und ebenso runden Glasfenstern aus blauem Mosaik geleitetes Licht füllte den großen Saal Himmelhall des Tempels.
Stuhlreihen, bogenförmig angeordnet, waren auf eine Art Altar gerichtet, ein hellovaler und niedriger Steinblock, auf dem links eine weiße und rechts eine schwarze Kugel ruhte. Der Steinblock selbst befand sich in der Mitte eines leise plätschernden Wasserbeckens, von dem aus ein kleines Rinnsal auf die Besucher zufloss und in einer unsichtbaren Absenkung im Boden verschwand. Himmelhall war kühl, es roch nach einer Mischung aus Tabak, Holz, Moschus und Erde.
Der Saal war bis auf die letzten Stühle voll besetzt und lautes Stimmengewirr hallte und echote durch Himmelhall. Vereinzeltes hysterisches Lachen, wütende Stimmen und beunruhigende Worte.
In der vierten Reihe von vorne, rechte Seite außen, hatte der Ingenieur Edgar Vonnegut mit seiner kleinen Nichte Berta Platz genommen. Edgar Vonnegut hatte erkennbare Mühe, sich in einen der Stühle zu quetschen, da sein Bauchumfang beinahe doppelt so breit war wie die vorgesehene Sitzfläche. Nach einigen Minuten war es ihm gelungen und er wischte sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Dann strich er seinen imposanten Schnurrbart in Form und öffnete in dem Moment, als er sich unbeobachtet glaubte, die Schnalle seines straffen Gürtels. Neben ihm kicherte Berta vernehmlich, die ihren Onkel nicht aus den Augen gelassen hatte. Sie warf ihren Hut mit den blauen Bändern auf den Boden, stellte die Fußspitzen auf den Stuhl ihres Vordermanns, richtete die Puppe auf ihrem Schoß aus und begann, sich neugierig umzusehen. Edgar Vonnegut murmelte ein paar strafende Worte und versuchte, sich nach dem Hut zu bücken. Schließlich gab er seufzend auf und tat es Berta gleich.
Dieser Morgen war… anders. Edgar hatte es bemerkt und wie hätte er es auch nicht bemerken sollen. Schon in dem Augenblick als er mit seinem nagelneuen Automobil in den Tempelhof eingefahren war, sah er es. Die gesamte Oberstadt hatte beschlossen heute zur Predigt zu erscheinen. Edgar wusste, die Gerüchte, die waren schuld. Das Gerede, die Sensationsgier und der Wunsch, es wie Besorgnis aussehen zu lassen. Aber Oberstädter machen sich äußerst selten Sorgen. Warum sollten sie auch? Konnte doch niemand Sicherheit in Gefahr bringen, die von zentnerweise Diamanten und Stacheldraht geschützt wurde. Edgars Augen schweiften umher. Erste Reihe, das Haus Sternberg mit Zia, Tochter und Gefolge. Daneben Marciella von Bahlow, die vollständig verschleiert war und, wie Edgar feststellte, ohne Großmutter Lyssa und Tochter Falka. Ganz in der Nähe die reiche Tänzerin Eleonora Bonadimani. Links außen der komplette Stadtrat mit Familien aufgereiht: Präsidentenfamilie Caspote, Magritte, Cixous und… Verdammmich Dogan , dachte Edgar. Mendax der elende Dreckwühler ! Adam Rothaar war nicht zu sehen und auch seine Frau nicht. Eigentlich niemand aus dem Haus. Edgar spürte ein kurzes Gefühl der Besorgnis. Konnte an dem Gerücht etwas dran sein, welches ihm heute vom Dienstmädchen mit der Milch überbracht wurde, dass Rothaars eigener Sohn genau in dieser Nacht…
Читать дальше