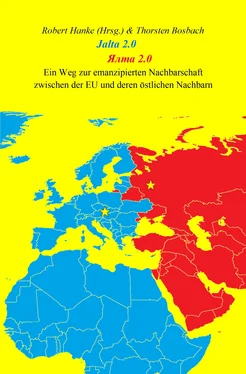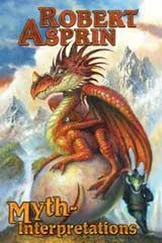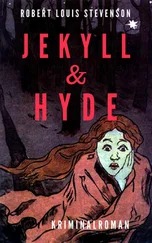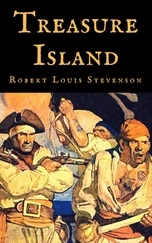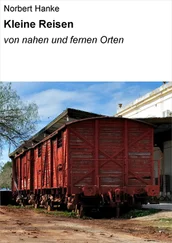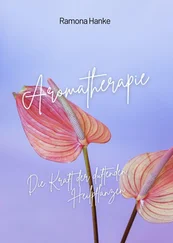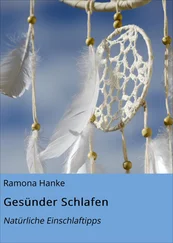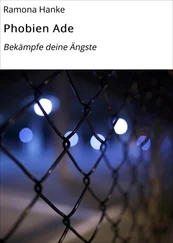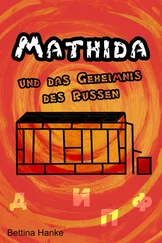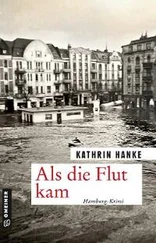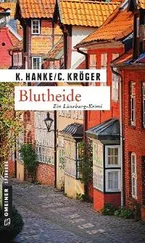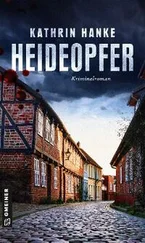4. Konstruktive EU-Außenpolitik
Die Definition, welche Art von EU-Außenpolitik als konstruktiv angesehen zu werden hat, kann sowohl ganz generell als auch im Kontext der hier diskutierten Aufgaben festgelegt werden. Gleichzeitig befindet sich diese Definition im Spannungsfeld dessen, was gemeinhin als wertorientierte versus interessengeleitete Außenpolitik verstanden wird. Die dritte zu betrachtende Dimension dessen, was als konstruktiv zu gelten hat, ist die Frage, mit welcher Art von Verhandlungspartner man es im jeweiligen Fall zu tun hat.
4.1. Das hohe Ross einer werte-gebundenen Außenpolitik
Zyniker würden behaupten, dass moderne Außenpolitik, zumal in Zeiten der Globalisierung und deregulierter Finanzmärkte, grundsätzlich und immer interessengeleitet sind. Dies trifft jedoch nicht zu. Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen, wobei man aber nicht vergessen darf, dass es, neben dem europäisch-westlichen, auch ganz andere Wertfundamente gibt. Sie mögen uns uns fremd und barbarisch anmuten, aber ebenfalls Werte darstellen, sie als solche in den meisten Fällen nicht verhandelbar sind. Die Beispiele im folgenden sind:
- Der Iran befand sich von 1979 bis 2015 aufgrund der stringenten Gebundenheit seiner Außenpolitik an die Werte der Islamischen Revolution in einer bewusst in Kauf genommenen wirtschaftlichen und politischen internationalen Isolation.
- Die amerikanische Israel-Politik hat die USA seit 1948 etliche Milliarden Dollar an Direkthilfen und entgangenen Umsätzen gekostet, ohne dass diesen jemals auch nur ansatzweise vergleichbare wirtschaftliche oder politische Gegenwerte gegenüber gestanden hätten.
- Das viele Geld, welches saudische Geschäftsleute zur Unterstützung salafistischer Bewegungen, Moscheen und Milizen ausgeben, wird auch nie eine wirtschaftlichen Mehrwert erbringen und ist somit alleine mit dem Wertefundament des Wahabismus erklärbar
- Nicht zuletzt die Europäer, auch in ihrer Inkarnation der Europäischen Union, werden von außen, nicht zuletzt auch aufgrund ihrer Kolonialgeschichte, oft als jene wahr genommen, die mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt laufen und glauben, alles besser zu wissen als der Rest der Welt. Selbst den oftmaligen Verweis der Europäer auf universelle Menschenrechte, Umwelt- und Klimaschutz oder das Übel von Korruption wird in dem Kontext als Eurozentrismus übel genommen.
Auch aus europäischer Sicht muss konstatiert werden, dass, zumal seit den Terroranschlägen am 11. September 2001 , sich die nationale und die gemeinsame Außenpolitik der Europäer und der EU in allerbester Absicht immer wieder selbst ein Bein gestellt hat. Diese allerbesten Absichten waren es, die in der Vergangenheit zu den meisten der in Abschnitt 5.1. diskutierten Fehlwahrnehmungen mit ihren teils tragischen politischen Konsequenzen führten.
4.1.1. Das Schließen von uns auf andere
Alleine schon die oben genannten so unterschiedlichen Beispiele USA/Israel und Iran werfen ein Schlaglicht darauf, wie unterschiedlich Wertefundamente sind und was passiert, wenn diese Unterschiede nicht wahrgenommen und zugelassen werden. Bedauerlicherweise passiert uns das am häufigsten mit Gesellschaften, von denen wir glauben, dass sie uns kulturell sehr ähnlich sind, obwohl sie das, wie in Abschnitt 5.1.5. beschrieben, in Wirklichkeit gar nicht sind. Die Ukrainer selbst kennen die Mentalitätsunterschiede, die wie ein Riss durch ihr Land gehen, werden sie aber, allein schon aus Gründen der Aufrechterhaltung ihres Selbstwertgefühls, niemals freiwillig nach außen kommunizieren.
Es bleibt die Frage: Hätten wir, ohne die politischen Verhältnisse vor Ort im Detail zu kennen, diesen Bruch erkennen können müssen? Die Gegenfrage muss lauten: Entspricht es wirklich einem Wertegerüst oder nicht doch eher einer Aufmerksamkeitsökonomie, zu übersehen, dass die Ostukraine weder 2004 noch 2014 an den Protesten teilgenommen hat. Die Antwort auf die erste Frage lautet also: Ein aufmerksamer und unvoreingenommener Beobachter hätte dies bemerkt und sich zumindest gewundert.
4.1.2. Die überschätzte Zivilgesellschaft
Die eben beschriebenen blinden Flecken sind die eine Seite einer ungleichgewichtigen Betrachtung. Im Gegenzug kommen an anderer Stelle Themen überhöhte Aufmerksamkeit zu, die, bei aller sachlichen Berechtigung, der vertieften Zusammenarbeit mit einem kulturfremden Partner im Wege stehen können. Dies trifft in besonderem Maße auf die Zusammenarbeit mit Ländern zu, die durch Stammesgesellschaften geprägt sind, die der Westen bei der Kodifizierung von Vereinbarung mit Einheimischen nie verstanden hat.
In etlichen, insbesondere in islamischen, haben Al-Qaida und später Daesch die Struktur und Funktionsweise dieser Stammesgesellschaften wesentlich besser einbinden können als der Westen und als Resultat gegen diesen dann auch beachtliche Erfolge erzielen können. Der Westen wird in diesen Ländern sich so lange wieder und wieder eine blutige Nase holen, solange er Zivilgesellschaften zu Lasten von Stammesgesellschaften zu maßgeblichen Verhandlungspartnern definiert. Zumindest in den islamischen und nicht-islamischen Ländern Afrikas, die auch nach einer Demarkation eine Daueraufgabe für die Europäische Union darstellen werden, ist und bleibt die Berücksichtigung von Stammesstrukturen bei der Auswahl primärer Verhandlungspartner zwingend.
4.1.3. Humanismus – etwas spezifisch westliches?
Der Humanismus ist, entgegen der fatalen Fehleinschätzung auch vieler Geisteswissenschaftler kein Konzept mit dem sich das ideale Zusammenleben der Menschen in einer universell für alle Völker dieser Welt maßgeblichen Form erklären ließe. In der ihm eigenen Weise verbindet der Humanismus die Antipoden Individualität und Mitgefühl miteinander. Wenn er in seiner grundlegend dialektischen Weise, auch alternative Formen menschlichen Zusammenlebens als nützlich anzuerkennen, nicht verstanden wird, mündet er in seinem verkürzten Verständnis rasch im zuvor zentrierten Eurozentrismus.
Der schärfste Antipode des Humanismus im 21. Jahrhundert ist der Islamismus . Dessen Beliebtheit speist sich zum einen aus dem von außen wahrgenommenen Eurozentrismus, zum anderen aber auch aus der Ablehnung jeglicher Individualität als nicht „gottgefällig“. So kompatibel moderne Zivilgesellschaften mit dem Humanismus in der Entfaltung der Individualität sind, so kompatibel ist der Islamismus mit archaischen Tribalismus in der Indossierung starrer familiärer, sozialer und gesellschaftlicher Strukturen, Vermittlung von Vertrautheit und Geborgenheit sowie der Ablehnung alternativer Formen menschlichen Zusammenlebens.
Der Islamismus findet dort seine günstigsten Einfallstore, wo tribalistisch geprägte Menschen sich von westlichen Verhandlungspartnern oder westlichen Mehrheitsgesellschaften abgelehnt, ausgeschlossen, unbeachtet oder unverstanden fühlen. Aufgabe eines nicht eurozentristisch agierenden Humanismus ist daher eine weitestgehende und respektvolle, auch empathische, Inklusion, die, im Falle des Erfolges, dem Islamismus weitere Expansionsräume verschließt.
Diese Aufgabe ist universell. Sie stellt sich in der Gestaltung der Beziehungen mit allen islamischen Ländern von Marokko bis Indonesien , aber auch der Gestaltung des Zusammenlebens mit den bei uns lebenden islamischen Minderheiten. Auch die Russen, obschon selbst keine Experten für Humanismus, beobachten uns genau, inwieweit wir in der Lage sind, die von uns selber hochgehaltenen Prinzipien der Menschlichkeit selber stets in die Tat umzusetzen.
4.1.4. Kodifizierung im politischen Raum
Читать дальше