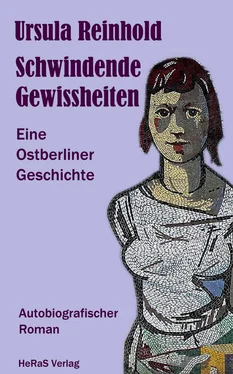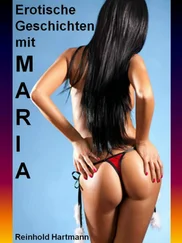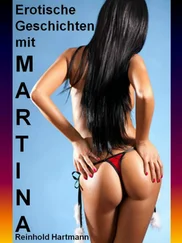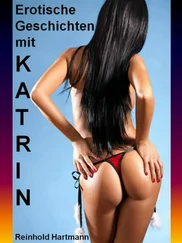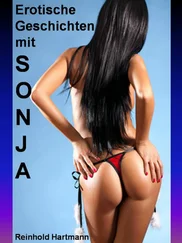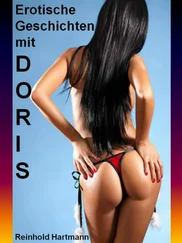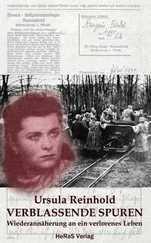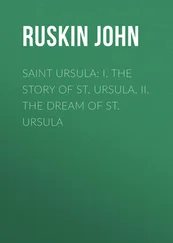1 ...7 8 9 11 12 13 ...26 Wenig hörte sie von den Worten der Tanzschöpfer, die sich mit der Erwartung verabschiedeten, dass ihnen mit dem Lipsi ein Wurf gelungen sei, der der DDR- Unterhaltungskultur Auftrieb geben werde. Sie legten es in die Begeisterung der Anwesenden, diesen Tanz weiter zu empfehlen. „Ihr könnt viel tun dabei“, riefen sie in den kleinen Saal, bevor sie sich verabschiedeten.
Gisela tanzte von früher Jugend an im Vereinsheim ihrer Laubenkolonie modische Tänze, die der Vater immer nur Gehopse nannte. Deren Rhythmus war ihr stärker in die Beine gefahren, als dieser Tanz hier, der sie mehr an den Reigen erinnerte, den sie als Kinder bei Sommerfesten einstudiert hatten.
Es war nicht der Tanzrhythmus, der sie an diesem Abend wie auf Wolken durch die menschenleeren Straßen gehen ließ, die sie sonst niemals ohne Beklemmung durchquerte.
Seitdem lebte sie in gehobener Erwartung. Hoffte, dass er den Lesesaal betrat, erwartete, ihn während des Mittagessens zu treffen. Wenn sie sich sahen, grüßte er sie freundlich und aufmerksam. Sie wartete auf seine Blicke. Jetzt kam ihr in den Sinn, was Edith über ihn erzählt hatte und sie spitzte die Ohren, wenn sein Name im Gespräch fiel, war in ständiger Alarmbereitschaft. Eines Tages hörte sie, wie Helga Pietsch zu Edith Gütze sagte: „Das muss man sich mal vorstellen, der große Mann mit der Kleenen!“ Die andere lachte und meinte: „Naja, wenn es beim Tanzen bleibt.“ Nach einem Moment bekam Gisela mit, dass sie gemeint war. Ein kleiner Schreck durchfuhr sie, dann sagte sie sich, dass sie das aushalten würde.
Plötzlich stand der Tänzer vor ihr im Lesesaal. Obwohl sie darauf gewartet hatte, traf es sie unvorbereitet. Die Röte schoss ihr ins Gesicht als sie zu ihm hochblickte. Er kam nicht ihretwegen, sondern brauchte zwei Bücher aus der Staatsbibliothek. Das gehörte, seitdem der Lesesaal eingerichtet war, zu ihren Aufgaben. „Fernleihe“ hieß der Vorgang, den sie zu organisieren hatte. Sie trug für die Dozenten und Aspiranten Bücher aus der dreihundert Meter entfernten Staatsbibliothek in die Taubenstraße. Sie tat es nicht ungern, konnte sie doch tagsüber ihren Arbeitsplatz verlassen, durch die Straßen gehen. Außerdem traf sie dort diesen und jenen. Die große Bibliothek verlor in dieser Zeit ihren Schrecken für sie. Die Büchertaschen, die sie trug, waren schwer, sie musste sie mehrmals absetzen bis sie am Ziel war. Da fuhr manchmal ein führender Genosse, dessen Bücher sie in der Tasche trug, im Auto an ihr vorbei, aber man sah sie wohl nicht mit ihrer schweren Tasche.
Es handele sich um Bücher, in denen die philosophische Epochenproblematik behandelt wurde, erklärte ihr der Mann. Vom bürgerlichen Standpunkt natürlich, fügte er nach einer kurzen Pause hinzu. Was damit gemeint war, wusste Gisela nicht. Aber sie wollte in ihrem großen Brockhaus nachschau-en, der hinter ihrem Arbeitstisch stand. Als er gegangen war, spürte sie freudige Erregung. Er war nicht ihretwegen hier, aber er würde wiederkommen. Es gab ein Band zwischen ihnen und sie würde zu verstehen suchen, was ihn beschäftigte. Das erschien ihr wie ein Weg zu ihm hin. Tage später kam er, die bestellten Bücher abzuholen. Sie musste ihm sagen, dass sie noch nicht hier waren, und er schien erst jetzt zu bemerken, dass sie es war, die die Wälzer herbeischaffen musste. Er schlug vor, sie bei ihrem nächsten Gang zu begleiten. Darauf freute sie sich, war erleichtert, ihm beweisen zu können, dass nicht sie die Schuld daran trug, dass er seine Bücher noch nicht hatte.
Sie ging gern neben ihm, nicht nur weil er ihr die Büchertasche trug. Er erkundigte sich nach ihrer Ausbildung und gestand, dass er die große Bibliothek das erste Mal betreten würde. „Ich hoffe, Sie werden mir sagen, wie ich mich zurechtfinden kann“, meinte er, an Gisela gewandt, die sich durch seine Anrede erhöht fühlte und ihm gern die Geheimnisse der großen Bibliothek erklären wollte. Ein wenig überraschte es sie, dass es bei einem so erwachsenen Mann nötig war. Es gehe jetzt darum, endgültig die Höhen von Kultur und Bildung zu erstürmen, auch er wisse viel zu wenig, wolle die Zeit nutzen, um sein lückenhaftes Wissen zu vervollständigen. Dieses Eingeständnis brachte Gisela dazu, ihm zu erzählen, dass sie den von ihm verwendeten Begriff Epochenproblematik gesucht und weder im großen Brockhaus, noch in sonst einem Lexikon gefunden hatte. Für ihren Wissensdurst lobte er sie, wie es auch ihr Vater immer tat, erklärte ihr aber, dass sich diese Lexika nicht auf der Höhe der Zeit befänden. „Unserer Zeit“, schloss er an und meinte, „die richtigen Bücher über uns werden jetzt erst geschrieben.“ An einem dieser Bücher war er selbst beteiligt mit dem Stichwort über einen der wichtigsten Grundsätze unserer Epoche, der friedlichen Koexistenz. Gisela hörte ihm aufmerksam zu, hatte das Gefühl, dass er den Schlüssel bei sich trug, den sie für ihr Leben suchte. Er kam ganz unversehens von philosophischen Fragen auf seine Eltern zu sprechen, erzählte vom Vater, einem Metallformer, und von sich selbst als dem Arbeiterkind, das zum Zünglein an der Waage geworden ist. Sie fand sich wieder in dem, was er sagte, wie er sie anhörte, ihr beipflichtete, sie nicht zurückwies mit Worten.
In den nächsten Wochen dachte sie häufig an dieses Gespräch, hoffte, dass es sich wieder ergeben würde. Sie wartete. An einem Freitagabend im Juni, sie schloss die Fenster, die sie in der lauen Luft jetzt den ganzen Tag offen ließ, stand er plötzlich hinter ihr, lud sie zu einem Ballettabend in der Deutschen Staatsoper ein. Es traf sie wie ein freudiger Blitz, sie sagte ohne zu zögern zu. Bei früheren Bekanntschaften hatte sie sich ein wenig geziert, das kam ihr jetzt nicht in den Sinn. Solches Flunkern verbot sich, wenn sie nicht riskieren wollte, etwas zu verspielen. Er verabredete sich mit ihr zum Abendessen, zwei Stunden vor Beginn der Vorstellung. Die nächsten Tage lebte sie nur auf diese Stunde hin. Freudige Erwartung, aber auch Beklommenheit spürte sie. Sie schaute mit anderen Augen auf das Opernhaus, wenn sie den Opernplatz überquerte. Es würde das erste Mal sein, dass sie dort hineinging. Ihr Kleid aus Chinabrokat mit Teehäuschen auf blauem Grund würde sie anziehen. Für dieses Kleid hatte sie nach dem Abitur vier Wochen gearbeitet. Das war einige Jahre her und sie war unsicher, ob sie sich darin noch gefiele. Dazu die flachen, schwarzen, ausgetretenen Slipper, die halbwegs zu dem Kleid harmonierten. Sie bereute, sich nicht längst ein Paar Pumps gekauft zu haben. Die Warnungen ihrer Mutter hatten sie davon abgehalten, die sie im mühsamen Gang bei Frau Pietsch bestätigt sah. Jetzt hätte sie sich für den Mann gern etwas erhöht, wollte ihm näher sein. Die kichernde Stimme ihrer Kollegin klang ihr im Ohr, die den Größenunterschied zwischen ihnen herablassend kommentiert hatte. Auch mit der Handtasche war es so, dass die ihr eigentlich nicht mehr gefiel. Der Gedanke an die Accessoires bereitete ihr Missbehagen, aber das verdrängte sie und gab sich der Vorfreude hin.
Gajaneh
Er stand vor der Eingangstür zu den Rheinterrassen, als sie sich, vom Bahn-hof Friedrichstraße kommend, näherte. Freudig kam er ihr entgegen, nahm ihre Rechte in beide Hände. Große Hände waren es, ihre verschwand darin vollständig. Mit selbstbewusster Gewandtheit hielt er ihr die Tür zum Restaurant auf, um dann als erster hindurchzugehen, führte sie zur Garderobe, nahm ihr den dünnen Mantel ab. Er hatte zwei Plätze bestellt, an die ein befrackter Kellner sie führte, zum Sitzen aufforderte. Dann bestellte er für sie beide den Aperitif, den der Kellner anbot, nahm die Karte zur Hand und sagte, er hoffe, es sei ihr so recht. Ihr war es so und auch anders recht. Sie bewunderte die Gewandtheit, mit der sich Johannes bewegte. So nannte sie ihn für sich jetzt.
Später erinnerte sie sich nicht mehr an die Einzelheiten dieses Abendessen. Nur ein Vorfall blieb ihr im Gedächtnis und die Aufregung, die er ihr bereitete, und das Gefühl, der Zielpunkt aller Blicke im Lokal zu sein. Auch ihr Begleiter schien die Sache fatal zu finden, obwohl er unausgesetzt das Gegenteil behauptete, als er ihr mit einem Taschentuch die Soße vom Jäckchen putzte, das sie über dem ausgeschnittenen Kleid trug. Sie hätte das lieber schnell und unauffällig selbst gemacht, aber er ließ es nicht zu, putzte ausdauernd, zog ein Fläschchen Fleckenwasser aus der Innentasche seines Jacketts und rieb weiter. Sie fürchtete, dass der Stoff litt, und suchte sich ihm zu entziehen. Aber es dauerte noch eine Weile, bis er abließ, von ihrem Kleid.
Читать дальше