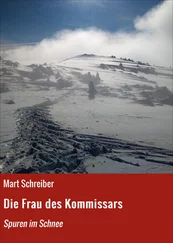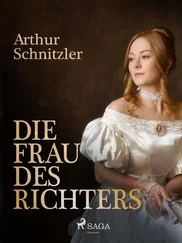Er betrat einen kleinen Raum, den er vor Jahren zwischen Haus und Stall angebaut hatte und der ihm als seine geheime Küche diente, entnahm einem der Regale einen Tiegel mit einer weißen Salbe, die er selbst gemischt hatte und die bisher immer gewirkt hatte, legte sich seinen Umhang an und ging die wenigen Schritte zum Turm.
Als er die Zellentür aufschloss, zuckte die Gefangene zusammen und sah ihn aus schreckensweiten Augen an.
„Sei ruhig“, besänftigte er sie. „Ich will nur nach deinen Wunden sehen.“
Als sie noch zögerte, fügte er leise hinzu: „Nachher wird es dir besser gehen.“
Er trat vor sie, half ihr, sich aufzurichten und sich das Hemd über den Kopf zu ziehen.
Der Anblick ihres ganzen Körpers war noch erschreckender als das, was er bisher gesehen hatte.
In aller Ruhe breitete er das Hemd auf dem Stroh aus.
„Leg dich hin“, sagte er, „erst auf den Bauch.“
Dann begann er ganz vorsichtig, ihren Rücken zu salben, ihren Po und die Oberschenkel.
„Kannst du dich umdrehen?“, fragte er, als er mit seiner Arbeit fertig war.
Unter Schmerzen folgte sie seiner Aufforderung.
Er hätte nicht sagen können, was schlimmer aussah, Rücken oder Brust und Bauch.
Er griff in den Tiegel, der schon zur Hälfte geleert war, verrieb die Salbe zwischen seinen Händen, bis sie geschmeidig und warm war, und strich sie ganz sanft auf Mathildes Körper. Um die heilende Wirkung zu verstärken, hätte er sie einmassieren müssen, aber er wusste, das würde ihr unerträgliche Schmerzen bereiten, und so ließ er es.
Wieder half er ihr aufzustehen, hielt sie leicht an den Schultern, als sie zu straucheln drohte, und gab ihr das Hemd zurück.
„Morgen komme ich wieder“, verabschiedete er sich und ging.
Natürlich komme ich morgen wieder, was soll ich sonst wohl machen, schalt er sich. Schließlich war er für die Gefangene verantwortlich, und dazu gehörte auch, dass er sie versorgte, egal, was ihr geschehen würde.
So einfach war das.
War es das?
Als er vor seiner Hütte stand, wäre er am liebsten gleich wieder umgekehrt.
Aber es gab keine Rechtfertigung dafür. Er hatte schon mehr getan, als seine Pflicht war.
Er öffnete die Tür und trat in die stickige Küche. Das Feuer im Ofen war fast erloschen, ein etwas größeres Scheit glomm noch und verströmte kaum Wärme.
Er sah sie vor sich, wie sie, festgebunden an den Pfahl, mitten in den Flammen stand, mit schmerzverzerrtem Gesicht, schreiend, wie die Flammen immer höher loderten, bis sie schließlich über ihr zusammenschlugen.
Wenn der Scheiterhaufen zusammengefallen war und nur noch einige wenige Scheite glühten, dann endlich hatte sie es überstanden. Nichts wäre von ihr übrig, Reste einiger weniger Knochen vielleicht.
Und er sah sich – wenn sie Glück haben würde - , wie er hinter ihr stand, als müsste er noch etwas richten, wie er in einem geeigneten Augenblick seinen Dolch ihr von hinten ins Herz stieß, um ihr weitere Qualen zu ersparen.
Früher als üblich suchte er seine Gefangene auf, um sich von ihrem Zustand zu überzeugen und ihr die tägliche Ration an Brot und Wasser zu bringen, wie er sich einredete. Dass er wieder die Salbe mitnahm, war fast selbstverständlich. Dass er noch in der Nacht ein Huhn geschlachtet und eine nahrhafte Brühe gekocht hatte, auch. Schließlich erwartete man von ihm, dass er eine einigermaßen gesunde Gefangene dem Gericht übergab.
Alles war also normal.
Aber er wusste, nichts von dem, was er tat, war normal, er konnte es sich einreden, so viel er wollte. Er würde sich mit der Normalität nicht abfinden.
Noch hatte er keinen festen Plan, nur eine vage Idee.
Aber er hatte auch Angst.
Fünf Tage war Mathilde bereits seine Gefangene, fünf Tage hatte er sie versorgt, hatte ihre Wunden gekühlt und mit seiner Salbe eingestrichen, hatte mit ihr gesprochen, wie er noch nie mit einer Gefangenen gesprochen hatte, mitfühlend, besorgt.
Früher hatte er am Morgen die Zelle aufgeschlossen, hatte die tägliche Ration an Brot und Wasser abgelegt, hatte den Kübel überprüft und, wenn er voll war, ausgeschüttet.
Nie wäre er auf den Gedanken gekommen, einem Gefangenen die Fesseln abzunehmen, ihn auch noch ein zweites oder drittes Mal am Tag zu besuchen, ihn zu trösten, ihm die Schmerzen zu mildern.
Seine Aufgabe war lediglich, ihn sicher zu verwahren, bis der Gerichtstermin gekommen war, und ihn hochnotpeinlich zu befragen, wenn er nicht gestand. Da war es nur natürlich, dass er jedes Gespräch, jedes persönliche Wort und vor allem jede Empfindung vermied.
Einmal, ziemlich am Anfang seiner Laufbahn, hatte er erlebt, dass ein Malefikant wahnsinnig wurde, weil niemand mit ihm sprach.
Über drei Monate musste er auf seinen Prozess warten, weil das Gericht, das nur dreimal im Jahr tagte, sich wenige Tage zuvor gerade vertagt hatte. Drei Monate eingesperrt sein in diesen dunklen Turm, nur einmal am Tag den Henker sehen, der wortlos die tägliche Ration ablegte und den Kübel leerte, dann wieder das Schließen der Tür zu hören und das Geräusch der schlurfenden Schritte, die sich langsam entfernten, und dann nur noch die fürchterliche Stille, die in seinen Ohren dröhnte, das alles hatte seinen Geist verwirrt. Mit fiebrigen Augen starrte er seinen Richter an, als er endlich vorgeführt wurde, zog fürchterliche Grimassen, die die Schöffen zu Tode erschreckten.
Es gab keinen Zweifel, in ihn war der Teufel gefahren.
Als er gefragt wurde, wie der Teufel aussähe, verzerrte sich sein Gesicht, und er lachte so schaurig, dass allen, die es hörten, ein eiskalter Schauer über den Rücken lief.
Selbst unter der Folter lachte er, stieß unverständliche Flüche aus.
Ein Geständnis war von ihm nicht zu erwarten, so sehr der Scharfrichter ihn auch auf der Streckbank zog und ihn über den Gespickten Hasen rollte. Er gebärdete sich nur noch toller.
Da befahl der Richter, ihn an den Pfahl zu binden und mit einem glühenden Eisen zu malträtieren. Noch einmal lachte er dieses grässliche Lachen, dann fiel sein Kopf zur Seite, und Richter und Scharfrichter schworen später übereinstimmend, sie hätten gesehen, wie der Teufel versucht hätte, seinen Körper zu verlassen.
Um ganz sicher zu gehen, dass er vernichtet worden war, verbrannte man den Leichnam auf dem Marktplatz unter reger Anteilnahme der Bevölkerung.
Damals hatte er sich geschworen, niemals wieder würde er einen Gefangenen die ganze Zeit über so völlig von der Welt abschneiden. Wenigsten während seines täglichen Besuches würde er mit ihm reden.
Er hatte diesen Schwur gehalten, hatte manchmal auch länger mit einem Malefikanten gesprochen, als unbedingt nötig war, aber noch nie so viel wie mit Mathilde.
Jetzt beschäftigte ihn der Gedanke an Mathilde schon den ganzen Tag. Wenn er seinen Karren durch die Gassen zog, um eine Grube zu leeren, dachte er an sie. Wenn er die Kübel im Fluss entleerte, durch das stinkende ätzende Wasser watete, sah er ihren geschundenen Körper, und die Furunkel und Eiterbeulen an seinen Beinen verloren ihren Schrecken.
War es denkbar, dass ihn mit dieser Gefangenen etwas verband, was er sich weigerte, einzugestehen, was aber immer mehr Besitz von ihm ergriff?
Wie hatte es geschehen können, dass er völlig vergessen hatte, dass sie eine Mörderin war, dass sie den heimtückischsten Mord begangen hatte, den man sich nur denken konnte?
Wer sagte ihm, dass es stimmte, was sie ihm über ihren Mann erzählt hatte?
Sicher, ihr Körper, die vielen, vielen Wunden und blaue Flecken schienen ihre Aussage zu bestätigen.
Aber taten sie das wirklich?
Kaum begannen diese Zweifel an ihm zu nagen, kämpfte er sie nieder, rief er sich ihr Bild ins Gedächtnis zurück, wie sie in den Turm gebracht worden war, dieses arme, geschundene Bündel Mensch, das er gepflegt hatte.
Читать дальше