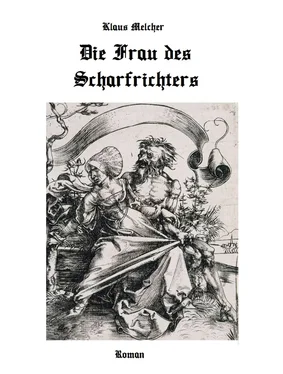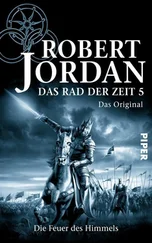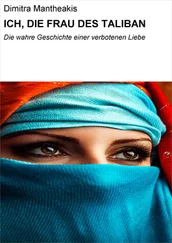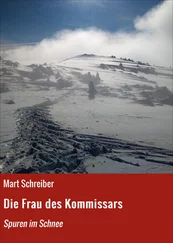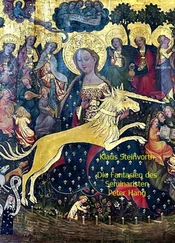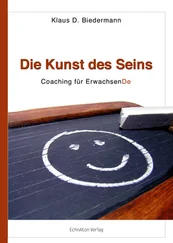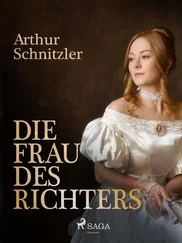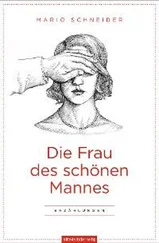Wenn auch nicht offiziell, so doch dem Ansehen der einfachen Bürger nach war er einer der wichtigsten Männer in der Stadt. Der Weg zum Bürgermeister führte über ihn, er entschied, wer vorgelassen und wer abgewiesen wurde, welches Gesuch dem Bürgermeister vorgelegt wurde. Er wusste alles, und er gab bereitwillig Auskunft über die Beschlüsse des Rates, und so manchem Bürger war eine frühe Auskunft eine gewisse Summe Geldes wert.
Heinrich eilte in das Zimmer des Bürgermeisters, der sich hinter einigen Folianten verschanzt hatte, und erstattete atemlos Meldung.
Was jetzt geschah, war reine Routine: die Stadtbüttel wurden vom Markt, ihrem eigentlichen Betätigungsfeld an diesem Vormittag, abgerufen, nur auf dem Bauernmarkt verblieben zwei, um die Anwesenheit der Obrigkeit zu demonstrieren.
Fünf Gruppen von jeweils zwei Bütteln wurden durch die Stadt geschickt, besuchten jedes Wirtshaus, jede Schänke.
Im „Hirschen“ wurden sie fündig.
„Ich habe mich schon gewundert“, sagte der Wirt, „der Oskar ist heute nicht auf den Markt gefahren. Den hat er bisher noch nie versäumt. Mein Knecht hat dem Pferd Hafer und Wasser gegeben, als Oskar sich bei Schlag neun immer noch nicht um Pferd und Ladung gekümmert hatte. Das war schon sonderbar.“
Natürlich war der Wirt bereit, den Toten zu identifizieren.
Wenn einer den Kaufmann Oskar erkennen könnte, dann wäre es er, schließlich schliefe er immer in seinem Wirtshaus, wenn er in der Stadt wäre.
Nachdem sich der Wirt seinen Umhang umgeworfen hatte, machten sich die drei Männer auf den Weg zum Gefängnisturm, in den man den Toten gelegt hatte.
In der Mauerstraße, die direkt unterhalb der Stadtmauer lag, hatte sich der Nebel noch nicht verzogen. Hier blieb er immer am längsten, blieb manchmal den halben Tag über, auch wenn die ganze Stadt und das Umland schon nebelfrei waren, als schämte sich dieser Teil der Stadt seiner Armut.
Und Recht hätte er gehabt.
Wie zerzauste Schwalbennester klebten die meist hölzernen Bruchbuden an der Mauer, zusammengezimmert aus Brettern und Balken, die die Eigentümer irgendwo zusammengesammelt oder gestohlen hatten.
Nur wenige Häuser gab es hier, ebenfalls an die Stadtmauer geschmiegt, die die Bezeichnung Haus einigermaßen verdienten. Auch sie waren schäbig, in verwahrlostem Zustand, überall notdürftig geflickt, mit löchrigem Dach, mit leeren Fensteröffnungen. Nur Gertraudes Bordell passte nicht in dieses Bild von Elend und Verfall.
Es war nicht protzig wie die Patrizierhäuser am Markt, verzichtete auf aufwändigen Zierrat an der Fassade, auf eine reich geschnitzte Eingangstür in einem marmornen Portal mit kunstvollen Steinmetzarbeiten. Nur ein Relief zierte das Portal: Eva lehnte sich verführerisch an einen Baum, lächelte geheimnisvoll und reichte Adam den Apfel. Unter ihrem Fuß wand sich vergeblich eine Schlange.
Und um ihren Besuchern den Eintritt in das Paradies zu erleichtern, hatte sie auf die Gasse im Bereich ihres Hauses Trittsteine setzen lassen, denn es gab hier unterhalb der Stadtmauer nicht einmal eine Gosse, die die Fäkalien aufnahm und zum Stadtgraben führte. Auf ganzer Breite schwamm die stinkende Brühe die Gasse hinab. Hier und dort verstopfte Unrat, den die Bewohner auf die Straße geworfen hatten, die Kloake und sie drang in Häuser und Höfe der Bedauernswerten.
Dazwischen wühlten Schweine, scharrten einige Hühner, spielten kleine Kinder und pfiffen Ratten.
Es war ein Ort zum Erbarmen.
Hier wohnten nur die Ärmsten der Stadt, die gesellschaftlich Geächteten, die Ausgestoßenen, die Kranken und Gebrechlichen, die keine Familie hatten und die man nirgends mehr aufnehmen wollte, denen die Türen des Hospitals verschlossen blieben.
Solange sie noch einen Funken Stolz hatten und nicht dauernd auf Almosen angewiesen waren, verbargen sie sich in ihren armseligen Verschlägen vor den Blicken ihrer Mitmenschen. Hatten sie aber auch ihre letzte Arbeit verloren, die eigentlich niemand mehr verrichten wollte, dann saßen sie inmitten des Unrats auf der Straße, verdreckt und stinkend wie die Gasse, voller offener Wunden und eiternder Geschwüre, die die Lumpen nur notdürftig bedeckten.
Und hier lebte der, der wichtig für die Stadt war wie kaum ein anderer, den man aber mied wie einen Aussätzigen, Wolfram der Scharfrichter.
Schon in vierter Generation versah er dieses Amt.
Nur sehr widerwillig hatte er die Ausbildung begonnen, hatte sich nicht damit abfinden wollen, sein Leben lang ausgestoßen zu sein, abseits zu wohnen, an einem eigenen Tisch im Wirtshaus sitzen zu müssen, aus seinem eigenen Becher zu trinken, weil man die Verunreinigung des Bechers nicht würde wegwaschen können.
„Sieh es doch mal von der guten Seite“, hatte sein Vater gesagt, „wer hat schon seinen eigenen Tisch? Wer wird so sehr gebraucht wie der Scharfrichter?“
„Aber keiner will mit mir reden“, hatte er eingewandt.
„Warte es nur ab“, hatte sein Vater geantwortet und ihm zum ersten Mal liebevoll die Hand auf die Schulter gelegt, „irgendwann spricht jeder mit dir, auch wenn er es eigentlich nicht will.“
Und dann hatte er ganz behutsam begonnen, ihn mit den Aufgaben und Tätigkeiten des Scharfrichters vertraut zu machen. Schon da hatte sich Wolfram vorgenommen, es mit seinem erstgeborenen Sohn ebenso zu handhaben.
Nur der zeigte trotz all seiner Bemühungen keine Bereitschaft, diesen Beruf zu erlernen, obgleich er wusste, dass er als Sohn eines Scharfrichters nie einen ehrlichen Beruf würde ergreifen können. Vielleicht würde er Abdecker werden können, wenn er besonderes Glück hatte, Bader oder Müller, würde die Tochter eines Abdeckers, Baders oder Müllers heiraten können, aber dafür brauchte er schon sehr viel Glück.
Trotzdem kehrte er seinem Vaterhaus den Rücken, und so hatten es alle seine Geschwister getan, obgleich oder vielleicht gerade weil ihr Vater es inzwischen zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht hatte.
Da der bisherige Heymlichkeitenfeger gestorben war und die Stadt niemanden, selbst unter den Armen nicht, gefunden hatte, der dieses Amt übernehmen wollte, hatte man es dem Scharfrichter angetragen. Auch wenn diese Arbeit scheußlich war, stinkend und ehrlos, hatte er sie angenommen, um sich ein Zubrot zu verdienen, denn die Zeiten waren für den Henker erschreckend schlecht geworden. Die Stadtwachen waren verstärkt worden, kein Bürger durfte nach Eintritt der Dunkelheit ohne Handlampe auf die Gassen und Straßen gehen, und traf man jemanden ohne Licht in der Öffentlichkeit an, drohten ihm empfindliche Geldstrafen.
Es gab kaum noch hochnotpeinliche Befragungen. Wer klug war und sich die Schmerzen ersparen wollte, gestand schon bei der Territion, noch bevor das Verhör begann, und die Folterinstrumente verrosteten fast an den Wänden oder wurden von Spinnweben überzogen.
Eine einzige Hinrichtung hatte es in den letzten drei Jahren gegeben, eine Hinrichtung mit dem Schwert, die er nach allen Regeln der Kunst durchgeführt hatte.
Mitten auf dem Markt hatte man das Schafott aufgebaut, ein Podest von etwa zehn Ellen im Geviert, zu dem sieben Stufen herauf führten. In der Mitte stand der Klotz, über den der Verurteile seinen Kopf legen musste, den der Scharfrichter mit einem meisterlichen Hieb vom Körper trennte. Wie hatten die mehr als tausend Zuschauer seine Arbeit bewundert, dieses leise Sirren des Schwertes, das trotzdem bis in den letzten Winkel des Marktplatzes zu hören war. Noch Tage später bewunderte man ihn deswegen.
Nur zehn Gulden, die übliche Gebühr für eine Hinrichtung mit dem Schwert, hatte er dafür bekommen, eine Missachtung seiner Kunst.
Die wenigen und erheblich billigeren Leibesstrafen gegen Diebe und Betrüger konnten ihn nicht ernähren.
Wenn man auch seine Dienste als Scharfrichter kaum noch brauchte, beim Leeren der Gruben riss man sich um ihn. In jedem Haus oder Hof waren die Gruben irgendwann voll und mussten geleert werden, und auch die Gosse konnte nicht immer auf den nächsten Regen warten, um gereinigt zu werden.
Читать дальше