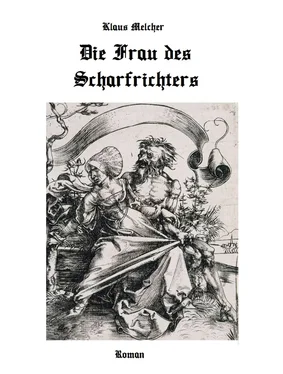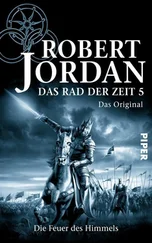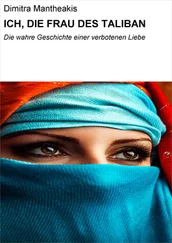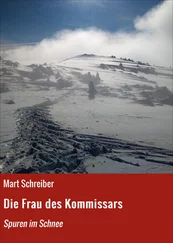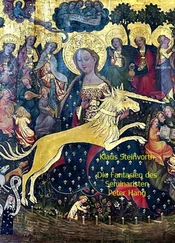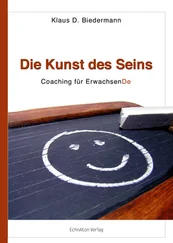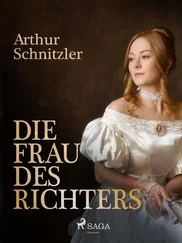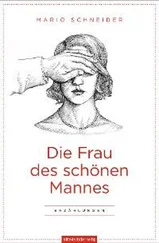Und er spürte die Überraschung, die Gertraude für ihn bereithielt, wenn er endlich in sie eindrang. Erst schien es ganz vertraut, doch dann, wenige Augenblicke später nur, erlebte er regelmäßig etwas völlig Neues, Überraschendes, was er nie für möglich gehalten hätte.
Doch heute, als kein Liebesgast mehr in dem Bordell war, ließ sie sich besonders viel Zeit, steigerte sein Verlangen fast bis ins Unerträgliche. Endlich fasste sie ihn bei der Hand und zog ihn in die dunkelste Ecke, eher eine enge Höhle, in der nur die Lagerstatt und eine kleine Truhe, einer Schatztruhe ähnlich, Platz fanden. Beleuchtet wurde der Raum von einer einzelnen Kerze, deren sanft flackerndes Licht ihm etwas Geheimnisvolles gab.
„Komm“, lispelte sie und zog ihn zu dem Lager, löste erst jetzt seinen Gürtel, streifte seine Beinkleider ab. Noch bevor er die Bettstatt erreichte, hatte sie ihm das Hemd über den Kopf gezogen. Und dann, gerade als er sie nehmen wollte, wie er es gewohnt war,
stieß sie ihn sanft auf das Lager, strich über seinen Körper, seine Brust, seine Hüften, seine Beine. Als er so gestreckt vor ihr lag, stieg sie, leicht wie eine Feder, auf ihn
und empfing ihn, wie sie es noch nie getan hatte.
„Sag es niemandem!“, flüsterte sie, und nachdem er es versichert hatte, umarmte sie ihn noch einmal voller Verlangen.
Er hatte genossen, was wohl noch niemand vor ihm genossen hatte, was außerhalb jeder Vorstellung lag. Hätte der Priester es erfahren oder der Bürgermeister oder irgendjemand vom Rat, sie wären verloren gewesen.
Als er Gertraude endlich verließ, nicht ohne das Versprechen, auf seinem Rückweg wieder bei ihr vorbeizukommen, war er glücklich wie nie zuvor.
Noch einmal drehte er sich nach ihr um, sah gerade noch, wie die Laterne abgenommen wurde und irgendwo im Haus verschwand, dann stolperte er erneut, wäre fast wieder in die Kloake getreten.
Mit einem Mal waren alle seine Glücksgefühle verschwunden. Er versank nicht mehr zwischen Gertraudes Brüsten, er tappte wieder durch den Nebel, leuchtete mit seiner Lampe den Boden ab, immer auf der Hut vor irgendwelchen Hindernissen, über die er stolpern konnte, einen abgenagten Knochen und Ratten, die sich um ihn stritten, ein Stück verfaultes Holz oder Lumpen.
Zu spät bemerkte er die andere Laterne, die sich ihm schwankend näherte.
Kaum spürte er den scharfen Stahl.
Nicht mehr merkte er, dass er abgetastet wurde, dass man ihm seinen Geldsack abnahm und ihn in die Kloake gleiten ließ.
Gefunden wurde er am frühen Morgen, als die Wachen ihren letzten Gang durch die noch schlafende Stadt machten.
Der Nebel, der die ganze Nacht die Stadt eingehüllt hatte, begann sich langsam aufzulösen.
Erst gab er die Turmspitze der Marktkirche frei, ließ die Wetterfahne golden glänzen, während das Dach des Kirchenschiffs mit seinen gnomengesichtigen Wasserspeiern
noch von Nebelfahnen gespenstisch umweht wurde.
Zögernd, als trauten sie dem Frieden noch nicht, traten die ersten Dienstmägde und Bürgersfrauen auf die Straße, schleppten ihre Eimer die Gassen entlang zum Marktplatz. Hier trafen sie sich am Marktbrunnen, jeden Tag, warteten bis sie an der Reihe waren und ihre Eimer füllen konnten.
Einige wenige fanden noch den Weg in die Marktkirche, nur zu einem schnellen Gebet, zu einem kurzen Niederknien vor dem Altar, bevor sie wieder nach ihren Eimern griffen, ein paar Worte mit der Nachbarin wechselten und dann nach Hause eilten.
Eigentlich hätten sie auf dem Marktplatz noch einige wenige Augenblicke verharren sollen, denn gerade neuem Leben. Die Sonne kam hinter dem Kirchturm vor, wanderte höher und tauchten die Marktsäule, Zeichen des ganzen Bürgerstolzes, in ihr noch fahles Licht, und plötzlich erstrahlte der Helm des Roland golden und verkündete: ‚Heute ist Markttag, und es herrscht Marktfriede in der ganzen Stadt! Wehe dem, der ihn bricht!’
Das war der Augenblick, in dem jedem Bürger, der Zeuge dieses Schauspiels wurde, das Herz aufging und er sich voller Stolz zu seiner Stadt bekannte.
Auch für die Torwachen begannen die Markttage früher als gewöhnlich.
Aus allen Richtungen rumpelten die Bauern der Umgebung mit ihren Karren herbei, beladen mit Feldfrüchten, mit Eiern und Wildhonig, mit derb gewebten Stoffen und Geräten, die die Bauern aus einfachen Mitteln herstellen konnten und auf dem Markt feilbieten wollten.
Angebunden mit einem Strick folgten den Karren vereinzelt eine Ziege oder ein Schaf, die in der Stadt an einen Metzger verkauft werden sollten. Gerne hätten die Bauern die Tiere selbst geschlachtet und das Fleisch auf dem Markt verkauft, doch die Marktordnung verbot ihnen den Handel mit frischem Fleisch. Und die Torwachen achteten schon bei der Einreise darauf, dass das Verbot eingehalten wurde.
Niemand, der verbotene Waren oder eine Waffe bei sich führte, durfte das Tor passieren.
Wie auf einer unsichtbaren Spur zogen die aus dem Norden kommenden Bauern die Nikolaistraße entlang und vereinigten sich mit dem Zug derer, die durch das Marientor im Süden die Stadt erreichten. Sie alle strebten den Bauernmarkt an, der etwas abseits des Hauptmarktes lag, von ihm durch eine schmale Durchfahrt zwischen Stapelhaus und Rathaus getrennt.
Während die Bauern ihre einfachen Stände aufbauten, erwachte auch das Leben auf dem Hauptmarkt. Von überallher kamen die Händler mit ihren Fuhrwerken, die die Nacht in einem der Wirtshäuser verbracht hatten.
Ihnen wurden die Standplätze in der Mitte des Platzes zugewiesen, die das Geviert zwischen Kirche und Stapelhaus im Osten und dem Rathaus mit öffentlicher Waage im Westen und den reichen Handelshäusern im Norden und Süden bildeten. Hier stellten die Herren der Stadt ihren Reichtum zur Schau, die Tuchhändler, die Fernhändler, die von ihrem Comptoir aus den Handel in die ganze Welt dirigierten, Segelschiffe mit Salz nach Bergen schickten und mit Hering beladen zurückkamen, Kaufmannszüge, die in Nowgorod Salz gegen Pelze tauschten, Gewürzhändler, deren Verbindung bis nach Indien und China reichte, Tuchhändler, die die feinsten Stoffe aus Venedig und Genua bezogen.
Ihre Häuser waren aus Stein gemauert, waren mit Ziegeln gedeckt, hatten aufwändig gestaltete Fassaden – und echtes Glas vor den Fenstern, nicht Horn oder gar nur Tierfelle.
Wer hier wohnte, herrschte in der Stadt, und er achtete sorgfältig darauf, dass niemand ihm seine Macht streitig machte. Er hatte sie von seinem Vater geerbt und der von seinem Vater. Mit allen Mitteln wurde sie verteidigt, gegen das gemeine Volk, gegen Emporkömmlinge, gegen die Kaufleute der Südseite – und gegen den Machtanspruch des Fürstbischofs von Würzburg.
Die meisten Häuser, die den Markplatz umgaben, waren von breiten Arkaden gesäumt, unter denen die Handelsherren während der Marktzeiten einige Stände aufgebaut hatten und ihre Waren anpriesen. Hier wurden die kleineren Kunden bedient, die nicht für würdig erachtet wurden, in die weiten Hallen vorzudringen, die sich im Innern anschlossen. Oder mit denen der Kaufmann gar in dem Comptoir im ersten Stockwerk verhandelte.
Das Treiben auf dem Marktplatz und unter den Arkaden nahm zu, die Händler feilschten mit den Kunden, die ersten Kaufleute hatten sich mit ihren Besuchern in die hinteren oder oberen Räume zurückgezogen, als plötzlich ein Raunen durch die Marktgassen ging. Niemand konnte später sagen, von wo es ausgegangen war. Plötzlich war es da, ganz leise, wie hinter vorgehaltener Hand, wurde lauter, immer noch unverständlich, denn nicht zu glauben war, was die Menschen hörten:
In der Unterstadt hatten die Nachtwächter einen Toten gefunden!
Das Gerücht, denn um ein solches musste es sich handeln, ergriff jeden, egal ob er auf dem Hauptmarkt war oder auf dem Bauernmarkt, verbreitete sich in Windeseile, bis es die eichenen Tore des Rathauses erreicht hatte und in die Schreibstube schwappte. Dort erfuhr es Heinrich, der Stadtschreiber, ein Mann von Mitte dreißig, der sich in seinem Amt behaglich eingerichtet hatte und sich ein kleines Zubrot mit Schreibarbeiten aller Art verdiente, so dass er seine Frau und seine fünf Kinder zwar nicht im Luxus, aber doch zufrieden stellend ernähren und kleiden konnte.
Читать дальше