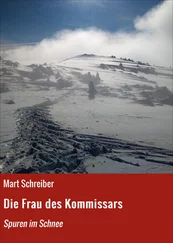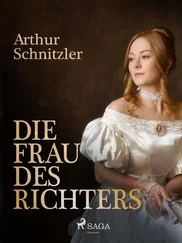So rief die Stadt oder der Hausbesitzer nach dem Heymlichkeitenfeger, und der schob seinen zweirädrigen Karren durch die Gassen, stieg in die Gruben, füllte die Eimer mit Fäkalien und ließ sie von seinem Gehilfen hochziehen, um sie in den großen Kübel auf dem Karren zu entleeren.
Mit seiner stinkenden Fracht zog er am späten Abend oder in den frühen Morgenstunden durch die Gassen, passierte das Nicolaitor, bevor es für die Bürger geschlossen oder die Landbevölkerung geöffnet wurde, denn ihnen sollten der Anblick und der Gestank erspart bleiben, stemmte sich in das Geschirr, als der Karren auf dem abschüssigen Weg an Fahrt aufnahm.
Wenn er endlich den Fluss erreicht hatte, ein ausreichendes Stück Weges ihn von der Stadt trennte, zog er den Karren auf der kleinen Furt in den Fluss und kippte vorsichtig den Kübel aus, so dass sich sein Inhalt in den Fluss ergoss, wo er sich mit der Brühe der Gerber und Färber der Stadt vereinigte.
Das war das Unangenehmste an seiner Arbeit.
Hier stank es nicht nur nach den Fäkalien, die er herbeibrachte, watete er nicht nur in den Haaren, Fleisch- und Fettresten, die die Gerber von den Tierhäuten schabten und in den Kanal oben nahe der Stadtmauer warfen. Hier stand er in dem Wasser, das die unterschiedlichsten Farben annahm und nach der ekelhaften Lohe stank, die ihm die Haut an den Beinen wegätzte. Bis zu den Knien waren sie mit Furunkeln und Schwären übersät, die, kaum waren sie verheilt, wieder aufbrachen.
Dann opferte er etwas von seiner Salbe, die er unter der Hand für teures Geld verkaufte, und nach wenigen Tagen hatte er keine Schmerzen mehr. Bis er wieder in den Fluss musste.
Vielleicht hätte er diese Tätigkeit aufgegeben, nachdem auch seine dritte Frau im Kindbett gestorben war und zwei Wochen später die Kleine ihr gefolgt war, noch bevor sie das Sakrament der Taufe empfangen hatte.
Alle Kinder seiner verstorbenen Frauen hatten das Haus verlassen, der Älteste war beim Müller in die Lehre gegangen, der Jüngere beim Abdecker, und die Tochter hatte einen ordentlichen Färber geheiratet.
Er lebte jetzt wieder allein, hätte sich eingeschränkt, für ihn allein hätte gereicht, was er als Scharfrichter verdiente.
Doch dann hätte er einsam in seinem düsteren Haus gesessen, das einzige Vergnügen wäre der gelegentliche Besuch des Wirtshauses gewesen. Dort hätte er abseits an seinem eigenen Tisch gesessen, hätte, wie sein Vater ihm erzählt hatte, aus seinem eigenen Becher getrunken. Aber er konnte sich darüber nicht freuen. Und so unterblieben die Wirtshausbesuche mit der Zeit.
Einen Besuch des Bordells konnte er sich nicht leisten, auch nicht den eines Badehauses. Und selbst wenn er das Geld gehabt hätte, man hätte ihn dort nicht geduldet. Nicht einmal an einem so verrufenen Ort.
So blieb ihm als einziger Zeitvertreib, wenn die Abende immer länger wurden, den schmalen Gang, der sein Haus mit dem Gefängnisturm verband, entlang zu gehen, die wenigen ausgetretenen Stufen zum Befragungskeller hinab zu steigen.
Dann saß er dort auf dem Befragungsstuhl, betrachtete die Figuren, die das flackernde Licht der Fackel auf die grob behauenen Steine zeichnete, fuhr mit den Fingern über die
verschiedenen Folterinstrumente, drehte an der Daumenschraube, prüfte die Elastizität der Peitsche, ließ einen Spannhebel an der Streckbank zurückschnellen. Dann träumte er sich zurück in eine Zeit, von der ihm sein Lehrmeister erzählt hatte, von einer Zeit, in der noch Gottesurteile über Leben und Tod des Beschuldigten entschieden, in der der Scharfrichter nur der weltliche Arm Gottes war.
Ja, so hätte sich Wolfram gern gefühlt, als weltlicher Arm Gottes, dessen einzige Aufgabe es wäre, Gottes Urteil auszuführen.
Laut und dumpf wurde an die schwere hölzerne Tür des Turmes geklopft.
Nachdem sich Wolfram überzeugt hatte, dass der Wirt vom „Hirschen“ und zwei städtische Büttel vor der Tür standen, öffnete er.
„Kommt“, sagte er und ging einen schmalen, leicht abschüssigen gemauerten Gang entlang. Beinahe wäre der Wirt auf dem unebenen steinernen Boden ausgerutscht, der immer feuchter wurde, je tiefer sie in den Keller vordrangen. Dort, wo es am kältesten war, wurden die Toten gelagert, die innerhalb der Stadt Opfer eines Verbrechens geworden waren. Hier lagen sie, bis sie identifiziert waren und die Ermittlungen abgeschlossen waren und man den Prozess beginnen konnte.
Noch drei ausgetretene Stufen, und die vier Männer standen vor einer schweren, mit Eisen beschlagenen Tür.
Wolfram zog einen Schlüssel hervor und schloss rasselnd die Tür auf.
Feuchte, modrige Luft schlug ihnen entgegen. Die Männer wagten kaum zu atmen, zu oft hatte man schon gehört, dass faules Gas, das sich in toten Körper bildete, Besitz von den Gesunden ergriff.
Angewidert warf der Wirt einen flüchtigen Blick auf den Toten. Ja, sagte er, es handle sich um seinen Schlafgast, der immer, wenn er in der Stadt wäre, bei ihm einen Schlafplatz miete. Er hätte sich schon gewundert, dass er nicht früh am Morgen sein Pferd versorgt hätte, wie es gewöhnlich seine Art wäre. Nein, er könnte auch nicht sagen, mit wem er sich getroffen hätte. Hier in der Wirtsstube jedenfalls wäre ihm nichts aufgefallen. Er könnte sich allerdings denken, dass er eine der Huren aufgesucht hätte. Man sollte vielleicht einmal dort nachfragen.
Die Befragung der Huren ergab, dass er Gertraudes letzter Gast gewesen war, dass er sie völlig unversehrt nach Mitternacht verlassen hätte und dass sie, nachdem seine Laterne in dem Nebel verschwunden wäre, die Tür verschlossen und sich zu Bett begeben hätte.
Weiter könnte sie nichts sagen.
Alle Nachforschungen des Gerichts liefen ins Leere.
Der Besuch bei der Hure schien tatsächlich der einzige Kontakt an dem Abend gewesen zu sein, die Begegnung mit dem Mörder reiner Zufall.
Das Volk hatte sich gerade wieder beruhigt. Immer wieder neue Gerüchte und Verdächtigungen, die die ersten Wochen die Runde durch jedes Wirtshaus, durch jede Gaststube, selbst durch die Zunftstuben und die Stuben der Kaufmannsgilde machten, verebbten langsam.
Die große Sensation, die alle erwarteten, war ausgeblieben, es gab keinen Angeklagten, keine hochnotpeinliche Befragung, keinen Prozess, keine Hinrichtung.
Der Mörder blieb unentdeckt, und das war das einzig Unbehagliche, er lebte unter Umständen noch hier, mitten unter ihnen.
Das Leben in Sülsheim ging wieder seinen gemächlichen Gang, die kleinen alltäglichen Sorgen bestimmten wieder den Tagesablauf. Feuerholz für den Winter musste eingefahren werden, die Kloake war schon wieder voll, das Schwein musste geschlachtet werden, der Schmied verprügelte wieder seine Frau, auf dem Markt hatte man Klothilde, die Frau des Bäckers Harald dabei ertappt, dass sie einen Fisch angefasst hatte, um seine Frische zu prüfen. Erst als der Marktbüttel kam, war sie widerwillig bereit, den Fisch zu nehmen und die Strafe von dreißig Pfennigen zu zahlen.
Und dann plötzlich war alles anders. Der Fisch war nicht mehr wichtig, der kleine Dieb, der eine Brezel gestohlen hatte, das stinkende Fleisch des Metzgers Hagen und der Kaufmann, der falsch wog. Das, worüber man sich eben noch aufregte, hatte auf einmal jede Bedeutung verloren.
Mathilde, die Frau des Schmieds Wolfhard, hatte ihren Mann umgebracht.
Vergiftet hatte diese zierliche Frau ihn, diesen Hünen von Mann, der eine ausgewachsene Ratte mit bloßen Händen zerquetschte, der mit einem einzigen Hammerschlag ein Eisen so dünn wie ein Schwert schmiedete.
David hatte sich gegen Goliath erhoben und gesiegt.
Auch wenn viele – zumindest die meisten Frauen – volles Verständnis für Mathilde hatten, sich eher wunderten, dass sie ihr Leiden nicht früher schon beendet hatte, denn dass der Schmied seine Frau aufs Schwerste misshandelte, war stadtbekannt, so ging diese – letzte – Konsequenz doch zu weit.
Читать дальше