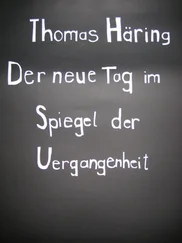Mir schauderte es, als sie mir befahl, mich neben sie zu setzten. Barsch fragte sie mich nun, was mich denn veranlasst hätte, so aus heiterem Himmel zu meiner leiblichen Mutter zu fahren? Und woher ich das Geld dafür gehabt hätte? Ich wollte ihr antworten, ihr erzählen, was mich dazu bewegt hatte. Doch als ich in ihr unbewegliches, hartes Gesicht blickte, aus dem mich zwei eiskalte Augen streng musterten, verließ mich mein Mut, ihr die Gegebenheiten zu erklären. Da ich nicht antwortete, herrschte sie mich mit den Worten, ich sei ein verstocktes, ungezogenes Kind, an.
Streng und bestimmend meinte sie, ich hätte absolut kein Recht, zu meiner Mutter zu gehen. Würde ich dies nochmals tun, würde sie dafür sorgen, dass ich in ein geschlossenes Heim käme. Das Geld für die Zugfahrt, unterstellte sie mir, hätte ich bestimmt gestohlen. Extrem verächtlich fuhr sie fort: „Deine Mutter hat dich noch nie gemocht. Sie hat dich und deinen Bruder fast verhungern lassen. Sie hatte immer nur Vergnügungen und Männer im Kopf. Bilde dir ja nicht ein, dass sie sich gebessert oder geändert hat. Lügen und Stehlen war bei ihr an der Tagesordnung. Eben ein Mensch der untersten Kategorie. Sie war und ist eine Rabenmutter, der alles andere wichtiger gewesen ist als ihre eigenen Kinder. Und vergiss nicht, sie hat dich noch nie geliebt und wird dich auch niemals lieben! Umsonst hat sie dich nicht zur Adoption freigegeben.“
Barsch fragte sie mich: „Hast du zugehört, was ich dir gesagt habe?“ Ich konnte nur mit dem Kopf nicken, denn in meinem Hals würgte es verdächtig und ich wollte vor dieser Frau partout nicht weinen.
In diesem Moment fasste sie derb mit ihrer Hand unter mein Kinn und hob meinen gesenkten Kopf auf ihre Augenhöhe hoch. Da ich meine Augen einfach geschlossen hatte, schüttelte sie meinen Kopf kräftig hin und her und brüllte mich an, sie anzusehen. Nochmals fragte sie mich, ob ich verstanden hätte, was sie mir von meiner Mutter erzählt hatte. „Ich möchte ein deutliches ‚Ja, von dir hören“, forderte sie mich schon fast kreischend auf.
„Ja“, murmelte ich mit immer noch geschlossenen Augen, damit sie zufrieden war. „Du sollst die Augen aufmachen, du kleines Miststück“, schrie sie mich nun, schon fast hysterisch werdend, an. Doch ohne Erfolg! Ich hielt meine Augen geschlossen. Sie meinte dann noch, was die Schule anginge, sollte ich mich endlich mal etwas anstrengen, sonst müsse sie öfter vorbei kommen und mir die Leviten lesen. Denn sie wolle nicht, dass ich so ein Vögelchen wie meine Mutter würde. Da ich immer noch, reglos wie ein Stock, mit geschlossenen Augen vor ihr saß, rastete sie komplett aus. Sie griff in meine Haare und zog meinen Kopf, soweit es ging nach hinten in den Nacken. Obwohl dies schmerzte, kam keine Träne aus meinen Augen, kein Laut über meine Lippen. Als sie ihre Erfolglosigkeit einsah, ließ sie abrupt von mir ab. Anschließend wandte sie sich Mama zu und befahl ihr, sofort jeglichen Kontakt zur Mutter sowie zu meinem Bruder zu unterbinden. „Auch lassen sie bitte absolute Strenge walten, denn Ulrike zeige jetzt schon Ansätze ihrer Mutter.“
Schwester Magdalena redete noch längere Zeit auf Mama ein, doch was sie ihr alles sagte oder anriet, flog an mir vorbei. Ich konnte nach allem, was mir Schwester Magdalena so einfach hingeschmissen hatte, keinen klaren Gedanken mehr fassen. Wem konnte ich denn eigentlich noch vertrauen, wem noch glauben?
Waren Mutters Tränen sowie ihre Worte, sie hätte den größten Fehler ihres Lebens gemacht und diesen schon bitter, bitter bereut, eine Lüge? Mochte sie mich wirklich nicht? Ja, sie hatte mich einfach hergegeben, mich in einen Lebensweg geschoben, der oftmals schwer und fast unerträglich für mich war. Ich fühlte mich in dem Moment auch von ihr zutiefst verletzt und betrogen. Nein! Ich wollte auch sie nie mehr sehen! Wieder einmal war ich mit meinen Gefühlen gegen eine Wand gerannt und musste damit fertig werden.
Mutter hatte sich nicht mehr gemeldet und somit bestätigten sich die Worte von Schwester Magdalena. Mutter wollte und mochte mich nicht! Seit dem Wissen über meine Herkunft und den Umständen fiel ich in ein tiefes Loch. Immer wieder hörte ich Schwester Magdalenas Worte, wie sie zu Mama sagte: „Lassen sie absolute Strenge walten.“ Wie streng sollte Mama denn noch werden?
Ich befand mich in dieser Zeit teilweise am Rande des Wahnsinns. Nachts plagten mich verdammte Albträume. Tagsüber fraß ich, bis mir übel wurde und ich mich erbrach. Mein Innerstes war total zerrissen und leer. Einige Male noch versuchte ich, mit Mama darüber zu reden, doch sie blockte sofort ab und meinte nur: „Du hast ja gehört, was Schwester Magdalena zu dir gesagt hat!“ Damit war für sie das Gespräch beendet.
Papa, der fast nie zu Hause war und wenn er abends kam, meist unter Alkohol stand, war genauso wenig Hilfe oder Gesprächspartner für mich. Ich fühlte mich verdammt einsam und alleine gelassen. Irgendwann fing ich an, mich mit einem Schal oder Band selbst zu strangulieren. Mir die Luft zum Leben zu nehmen. Wenn danach mein Hals schmerzte und mein Gesicht wie Feuer brannte, fühlte ich mich wieder stark. Langsam wurde mir bewusst, dass ich ein gewisses Potenzial an Schmerzen brauchte, um mich beruhigen zu können. Meine Eltern merkten von all dem nichts. Fragten sie dann doch mal nach einer meiner Verletzungen an Armen oder Beinen, war ich um Ausreden nicht verlegen. Außerdem stach ich mich meist an den Oberschenkeln, was durch die Kleidung dann fast nicht auffiel.
Allmählich bekam ich wieder Boden unter den Füßen. Das Lernen in der Schule machte mir zwar immer noch Probleme, doch langsam lief es etwas besser. Von den Schulkameraden und -kameradinnen wurde ich allmählich auch akzeptiert. Freundschaften bauten sich auf, welche mir ein Gefühl der Vollwertigkeit verliehen. Ich lebte auf und fand mein Leben wieder etwas lebenswerter.
Etwa drei Monate nach dem Ausbüchsen zu meiner Mutter sprach mich eines Tages Frau Dörfler, unsere Nachbarin, an und bat mich, doch mal zu ihr zu kommen. Sie war so etwas wie eine mütterliche Freundin für mich. Mama allerdings war nicht sehr begeistert, wenn ich zu dieser Frau ging, sie war in ihren Augen asozial. Frau Dörfler hatte fünf Kinder und lebte mit jenen alleinerziehend in sehr ärmlichen Verhältnissen. Sie kam öfters zu Papa und erbettelte sich Brot, Kartoffeln, Milch oder Gemüse, um ihre Kinder satt zu bekommen. Wie ich anfangs schon erwähnte, gab es zu dieser Zeit kein so ausgedehntes, gutes soziales Netz wie heute.
Frau Dörfler hatte hautnah meine Erziehung sowie manch anderes mitbekommen. Auch Mutter kannte sie gut, von den Besuchen her. Oftmals sagte Frau Dörfler zu mir: „Deine Mutter ist ein guter Mensch und jeder macht mal Fehler im Leben, verdamme sie nicht, sondern versuche, sie zu verstehen und ihr zu verzeihen. Ich weiß, von was ich rede, denn auch ich stand schon oft vor der Entscheidung, meine Kinder in eine Pflegefamilie geben zu müssen. Denn das bisschen Geld, was ich für die Kinder vom Jugendamt bekomme, reicht weder hinten noch vorne. Gott sei Dank geben mir dein Papa sowie manche Nachbarn immer wieder Lebensmittel, sodass ich mit meinen Kindern halbwegs überleben kann. Ich denke, dass dies bei deiner Mutter ähnlich war und sie deshalb die Nerven und den Kopf verloren hat.“
Obwohl Frau Dörfler diese Sätze öfters zu mir sagte, konnte und wollte ich mich mit dem Gedanken zu verstehen und zu verzeihen nicht anfreunden. „Mutter hat mich einfach weggegeben! Und nachdem ich bei ihr war, hat sie sich auch nicht mehr bei meinen Eltern oder mir gemeldet. Also ist doch Fakt für mich, dass sie mich nicht mag und auch keinen Kontakt mehr zu mir will“, gab ich Frau Dörfler bei solchen Gesprächen zur Antwort.
Dass ich zu Frau Dörfler kommen sollte, hatte ich zwischenzeitlich schon wieder vergessen. Mama hatte mir neue, rote Leder-Halbschuhe gekauft. Ich bettelte beim Schuhkauf, sie möge mir doch bitte, bitte endlich mal Sandalen für den Sommer kaufen und nicht immer Halbschuhe. Aber nein, es gab wieder Halbschuhe. Diese seien, wie Mama argumentierte, für die Füße gesünder. Dass ich darin im Hochsommer schwitzte, interessierte nicht. Aber ich hatte schon einen Plan im Kopf, wie ich aus den scheußlichen, geschlossenen Schuhen Sandalen machen könnte. Tags darauf setzte ich diesen dann auch um. Mit Bleistift zeichnete ich Ferse und Spitze an, dann schlich ich mich in die Speisekammer, wo das große Schinkenmesser lag. Unter Aufwendung aller Kraft säbelte ich die Spitze meiner Schuhe ab. Sorgfältig schnitt ich anschließend das Leder von der Laufsohle. Nun noch die Ferse herausschneiden, dachte ich, dann habe ich tolle Sandalen. Aber das Leder der Ferse war verstärkt und ich brachte es somit nur zu einer kleinen Ausbuchtung in der Fersenkappe. Juhu, ich hatte Sandalen!
Читать дальше