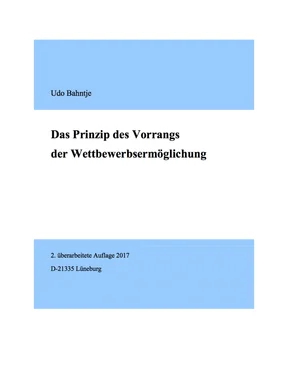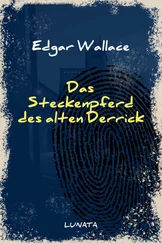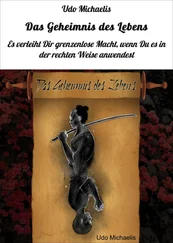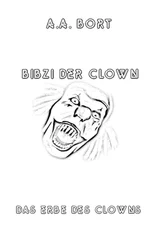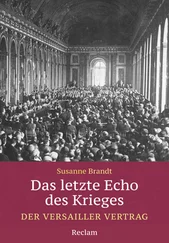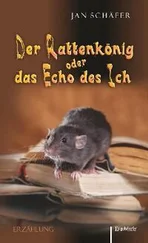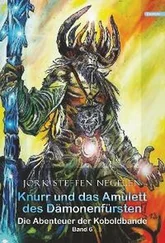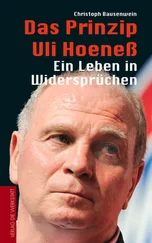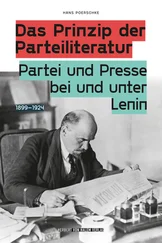2.) Klarzustellen ist weiter, dass es in dieser Untersuchung ausschließlich um die Darstellung und den Nachweis eines konkreten, neuen Prinzips geht und — so verlockend dies auch erscheint — nicht um eine allgemeine Diskussion neuer system- und prinzipientheoretischer Erkenntnisse oder gar um eine entsprechende Analyse. Ein solcher Exkurs würde das hier vorliegende Thema zum einen sprengen und zum anderen den Schwerpunkt zu sehr in einen allgemein-theoretischen Bereich verlagern, womit dem hier verfolgten Anliegen wohl eher geschadet würde. Daher soll insbesondere auf die Erkenntnisse einer neueren Prinzipientheorie von Alexy 9, die dieser in der Auseinandersetzung mit Dworkin 10und später unter Weiterentwicklung dieser Ergebnisse am Bezugspunkt einer Grundrechtstheorie 11erarbeitet hat, nur (nachdrücklich) hingewiesen werden. Doch soll das nicht daran hindern, auf Punkte, bei denen eine offensichtliche Übereinstimmung oder Abweichung zu den Ergebnissen Alexys erkennbar wird, auch hier (soweit relevant) aufmerksam zu machen. Wo ein solcher Hinweis fehlt, kann grundsätzlich von einer Übereinstimmung der theoretischen Implikationen auch mit den Thesen Alexys ausgegangen werden 12.
3.) Das weitere Vorgehen gliedert sich demnach in folgende Abschnitte:
Zunächst soll mit Hilfe der systematischen Methode, die (ebenso wie bei der Darstellung des Vertrauensprinzips bei Canaris 13) zur Ergänzung der induktiven Methode hinzugezogen wird, eine abstrakte Berechtigung des behaupteten Prinzips im Sinne einer systematischen Standortbestimmung dargelegt werden (B.). Sodann soll eine (nicht abschließende) Reihe positivrechtlicher Anknüpfungspunkte beschrieben und untersucht werden, aus denen auf induktivem Wege die „innere Notwendigkeit“ des Prinzips und seiner Abgrenzungskriterien extrahiert werden soll (C.). Abschließend sollen dann aus den gewonnenen Ergebnissen Folgerungen gezogen werden und das Prinzip an offenen oder (m.E.) nur unbefriedigend gelösten Problemen gemessen werden, wobei letztendlich im Ansatz auch eine deduktive Argumentation (gewissermaßen zur Probe aufs Exempel) zur Anwendung kommt (D.II.2.a).
Zweierlei ist dazu allgemein noch zu bemerken. Zum einen ist darauf hinzuweisen, dass die hier zum Zweck eines induktiven Nachweises angeführten Normen und Konstellationen, die die Existenz des Prinzips evident vor Augen führen und dieses zu beweisen imstande sind, stellvertretend auch für entsprechende Regelungen und Konstellationen in ausländischen Gesetzen stehen. Denn das Prinzip gilt naturgemäß nicht nur für den Geltungsbereich des GWB, sondern für jede freie Markt- bzw. Wettbewerbswirtschaft. Zum anderen ist aber auch zu sagen, dass hier ein neuer Gedanke zur Diskussion gestellt wird, dessen Umrisse und Konsequenzen noch nicht bis ins letzte ausgefeilt sind. Daher bitte ich darum, verbleibenden Unstimmigkeiten oder Unvollständigkeiten (im Blick auf das Wesentliche) mit Nachsicht zu begegnen. Insbesondere können sowohl die Fallgruppen oder Normbeispiele als „induktives Material“ (C.) als auch die Folgerungen und Konsequenzen (C. und D.) noch nicht abschließend oder erschöpfend dargestellt werden, was aber wohl nicht nur den subjektiven, sondern auch den (fehlenden) objektiven Möglichkeiten entspricht 14.
B.) Systematische Berechtigung und systematischer Standort des Prinzips
I. System und Prinzip
Canaris, an dessen methodisches Konzept im Folgenden angeknüpft werden soll, definiert ein System als eine „axiologische oder teleologische Ordnung allgemeiner Rechtsprinzipien“ 15. Letztere stellen sich also als Bausteine eines Systems dar, und zwar als Bausteine von unterschiedlicher Größe und Bedeutung. Denn ebenso, wie es etwa in der Molekularanordnung eines Kristalls (zumeist) größere und kleinere, in unterschiedlichen Frequenzen schwingende Bausteine gibt, müssen auch in der allgemeinen Rechtssystematik zunächst einmal Prinzipien unterschiedlicher Wesensart (insbesondere Rechtsprinzipien und rechtsethische Prinzipien 16), sodann (relativ) weitreichende und weniger weitreichende Prinzipien 17, Ober- und Unterprinzipien und andererseits ebenso Systeme und Untersysteme 18unterschieden werden, die in ihrem variablen, sich gegenseitig ergänzenden oder beschränkenden Zusammenspiel 19die „wertungsmäßige Folgerichtigkeit und innere Einheit des Rechts deutlich machen“ 20.
Dabei folgt bereits aus der Möglichkeit eines sich auch gegenseitig beschränkenden Funktionszusammenhanges die weitere Möglichkeit, dass sich Prinzipien — im Gegensatz zu Axiomen 21— auch untereinander widersprechen können und nicht ohne Ausnahme in ihrem Systembereich gelten 22. Zwei Beispiele sollen das Gesagte verdeutlichen.
II. Zwei Beispiele für Prinzipien aus dem Wettbewerbsrecht
1. ) Erstes Beispiel: Das Prinzip Wettbewerb
Das „Prinzip Wettbewerb“ ist seit Bestehen des GWB immer wieder als das grundlegende Prinzip des Gesetzes und darüber hinaus der gesamten (sozialen) Marktwirtschaft hervorgehoben worden 23. So heißt es etwa in dem Bericht des Bundestagsausschusses vom 29. Juni 1957: „Das Prinzip der Konkurrenzwirtschaft wird zum obersten Ordnungsgedanken des Gesetzes gemacht, wobei die Erkenntnis zugrunde liegt, dass die Wettbewerbswirtschaft allen anderen Ordnungen überlegen ist.“ 24
a) Dieses, dem Wettbewerbsrecht zugrundeliegende „Prinzip Wettbewerb“ lässt sich aber auch auf übergeordneter, wissenschaftsvergleichender Ebene nachweisen. So hat Michael Lehmann vom Standpunkt einer interdisziplinär höheren Warte, die einen vergleichenden Überblick über die Natur- und Geisteswissenschaften erlaubt, aus entsprechend umfassenderer Perspektive das „Prinzip Wettbewerb“ in einer vergleichenden Analyse der Wissenschaftsbereiche Evolutions-biologie, Ökonomik und Wirtschaftsrecht bestätigt gefunden 25. Diesen Bereichen soll neben dem „Prinzip Wettbewerb“ auch ein „Prinzip Eigennutz“ zugrunde liegen 26.
An dieser (den wissenschaftlichen Fachhorizont verdienstvoll erweiternden) Vorgehensweise wird deutlich, dass es insbesondere auf Standort und Perspektive ankommt, um entweder ein Prinzip oder ein (evtl. Unter-) System zu definieren. Denn es erscheint (ohne dass auf diese Frage hier näher eingegangen werden kann) ohne weiteres naheliegend, dass das „Prinzip Wettbewerb“ als ein „Grundelement der Evolution“ 27aus anderer Perspektive, gewissermaßen im Sinne einer systemtheoretischen Relativitätstheorie, auch als ein „System Wettbewerb“ begriffen werden könnte. Das gilt gerade dann, wenn man, was hier dahingestellt werden soll, das „Prinzip Eigennutz“ als eigenes Prinzip und nicht nur als Wett bewerbskomponente begreifen wollte 28. Diese Relativität zwischen Prinzip und System deckt sich jedenfalls gut mit den Ergebnissen von Canaris, der in seinen Prinzipien- und Systembeispielen z.B. den Gedanken der ungerechtfertigten Bereicherung oder den des Vertrauensschutzes zum einen als Beispiel für ein Prinzip, zum anderen (i.V.m. der dazugehörigen Haftung) als Beispiel für ein Untersystem anführt 29.
Dass ferner das Prinzip Wettbewerb nicht ohne Ausnahme gilt und sich mit anderen Prinzipien widersprechen kann, erscheint ebenfalls ohne weiteres einsichtig. Zwar ist nun gerade für das Beispiel der Evolutionsbiologie einzuräumen, dass es dort infolge der begriffsimmanenten Dynamik grundsätzlich eine „Wettbewerbsbeschränkung durch Zustand“ eigentlich per definitionem nicht geben kann, so dass dieser Aspekt von Lehmann insofern zu Recht nicht erwähnt wird, doch gilt dies schon nicht mehr für den Bereich der gewöhnlichen „statischen“ Biologie. Man denke nur an den „Glücksfall“ einer besonders vorteilhaften genetischen Erbmasse, die ein Individuum gegenüber seinen Konkurrenten zu einem (übrigens wohl auch als Prinzip vertretbaren) „beatus possidens“ erheben 30und es dadurch einem aufreibenden Wettbewerb in vielen Bereichen entziehen kann 31. Man denke aber auch an die Möglichkeiten der heutigen Gentechnologie (z.B. Herstellung eines interferonerzeugenden Bakteriums), durch die es vorstellbar erscheint, eine evolutionsbiologische Zwischenbilanz zu beeinflussen und letztere — potentiell auch willkürlich und vorteilsunabhängig (u.U. auch zurück in die Vergangenheit gerichtet) — zu verändern. Sofern man eine solche gewillkürte Künstlichkeit nicht etwa (da durch menschliche Intelligenz mittelbar bedingt) auch als per se evolutions-biologischen Prozess einstufen wollte — was m.E. unzutreffend wäre — müssen also selbst hier, im Grenzbereich der Evolutionsbiologie, letztlich doch Ausnahmen vom „Prinzip Wettbewerb“ zugestanden werden.
Читать дальше