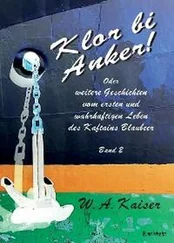Marita Brenken - Vom Essen und Lieben
Здесь есть возможность читать онлайн «Marita Brenken - Vom Essen und Lieben» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Vom Essen und Lieben
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Vom Essen und Lieben: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Vom Essen und Lieben»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Vom Essen und Lieben — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Vom Essen und Lieben», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Meine Eltern schlossen den Laden zwischen eins und drei. Dann war Mittagspause. Meine Mutter kochte ein schnelles Mittagessen, damit ich etwas Warmes zu Essen hatte, wenn ich aus der Schule kam. Sie machte Tütensuppe in Wasser heiß und schnitt Würstchen hinein, oder sie machte eine Dose Ravioli warm. Manchmal gab es Tiefkühlpizza, die ich besonders mochte, oder Kartoffelpüree, das sie aus der Packung nahm und mit heißem Wasser anrührte. Dazu gab es Fischstäbchen. Meinem Vater schmeckte es, und mir auch, wir waren nicht anspruchsvoll. Danach wurde eine halbe Stunde geruht. Jeder verkroch sich in seinem Zimmer, und das ganze Haus versank in eine wohltuende Trägheit. Ich lag auf dem Bett und blätterte in meinen Comics, die ich wie Schätze hütete, Micky Maus, Fix und Foxi, Asterix und wie sie alle hießen. Wenn mein Vater in der Küche stand und den Bohnenkaffee brühte, und der bittere Duft durchs Haus zog, war es Zeit für mich, zu meiner Mutter ins Schlafzimmer zu gehen. Sie saß in ihrem lässig geschlossenen Morgenmantel vor ihrer Frisierkommode, und betrachtete sich kritisch im Spiegel. Die Füße mit den roten Zehennägeln waren nackt, und die qualmende Zigarette hing ihr lässig im Mundwinkel, während sie sich mit einer Hand in ihr schönes langes Haar griff. Wenn ich leise die Tür öffnete, streckte sie den Arm nach hinten, in meine Richtung, und hielt mir ihre Haarbürste hin. Ich nahm sie wie ein wertvolles Geschenk entgegen, stellte mich hinter meine Mutter, und begann ihre Haare zu bürsten. Leise flüsternd zählte ich die Striche, die ich durch ihr Haar zeichnete. Hundert mussten es sein. Das Haar knisterte leise, und manchmal strebten einzelne Haare wie elektrisiert von ihrer Kopfhaut weg und mir entgegen, als wollten sie mich berühren. Während ich so durch ihr Haar strich, kam mein Vater ins Zimmer und stellte eine Tasse duftenden Kaffee vor sie hin. Er selbst behielt seine Tasse in der Hand. Er setzte sich schräg vor sie auf einen niederen Hocker und betrachtete versunken ihr schönes Gesicht, während sie rauchte, und ich die Bürste mit leisem Geräusch durch ihr Haare gleiten ließ.
„So, hundert“, sagte sie irgendwann, auch wenn ich noch gar nicht beim hundertsten Bürstenstrich angekommen war. „Es ist gleich drei.“ Dann wussten mein Vater und ich, dass wir den Raum zu verlassen hatten, weil meine Mutter sich in Ruhe ankleiden wollte.
Den Haushaltswarenladen meiner Eltern gibt es natürlich nicht mehr. Auch der Bäcker musste schließen, und der Fleischer, die Drogerie und der Schuhmacher. Der Bäckerwagen kommt alle zwei Tage, immer zur gleichen Zeit. Er steht auf dem Dorfplatz und läutet eine Glocke, die keine Glocke ist. Das Gebimmel kommt von einer CD, die vom Autoradio zu einem Lautsprecher übertragen wird, der auf dem Dach des Verkaufsfahrzeuges angebracht ist. Die Längsseite des Fahrzeuges wird hochgeklappt und eine Vitrine wird sichtbar, mit allen Brötchen und süßen Teilchen, die man sich wünscht. Dahinter steht die dicke Verkäuferin und hinter ihr sind die Regale mit den dicken Brotlaiben. Die Bäckerin kennt ihre Kunden genau und wartet, bis auch der Letzte aus dem Dorf bei ihr sein Brot gekauft hat. Dann wird der Wagen wieder zugeklappt und verschwindet bis zum nächsten Mal.
Der Fleischer kommt nur einmal in der Woche. Er fährt mit seinem Wagen durch ein großes Tor, direkt in den Gemeindesaal, weil er dort seine Kühlkammer installiert hat, in der er Würste, Schinken und Koteletts lagert. Der Gemeindesaal steht schon lange leer, hier gibt es keine Veranstaltungen und keine Versammlungen mehr. Nur eine Tischtennisplatte für die Jugendlichen, die aber immer nur dann benutzt werden kann, wenn der Fleischer da ist. Sonst ist das Gebäude abgeschlossen, aus Sicherheitsgründen. Dann gibt es noch einen kleinen Edeka und eine Kneipe, die aber erst abends um sieben öffnet und um zehn wieder schließt. Essen kann man dort nicht. Essen sollen die Dorfbewohner zu Hause, bei Muttern, oder bei der Ehefrau. Natürlich gibt es eine Kirche. Der Pfarrer kommt alle zwei Wochen sonntags vorbei, und hält eine Messe ab, öfter kann er nicht, weil er fünf Gemeinden zu betreuen hat. Die Kranken fahren nach Münster ins Krankenhaus, und auch die Kinder werden jeden Morgen, außer sonntags, mit dem Bus abgeholt und in die Schule nach Münster gefahren. Das Dorf ist sehr stolz auf seine freiwillige Feuerwehr, neben dem kreisrunden Löschteich, der von Schilf umgeben ist und einigen Entenpaaren Schutz gewährt. Die unsportlichen Männer aus dem Dorf sind bei der freiwilligen Feuerwehr, die sportlichen sind im Fußballverein, der seinen Bolzplatz im Nachbardorf hat. Ich mische bei beiden mit. Ich finde, man muss sich mit seiner ganzen Tatkraft in die Dorfgemeinschaft einbringen. Also freue ich mich auf jeden Feuerwehreinsatz. Es kommt ja selten vor, dass wir ausrücken müssen, eine Katze vom Dach retten, eine alte Scheune löschen, die Jugendliche abgefackelt haben, oder ein Wohnzimmer unter Wasser setzen, weil der Weihnachtsbaum wie Zunder brennt. Das ist wie ein kleiner Actionfilm für mich, in dem ich selbst mitwirken kann. Der Fußballverein ersetzt mir das Fitnessstudio. In meinem Alter muss ich schon was für meine gute Figur tun, also renne ich, bis mir die Zunge aus dem Hals hängt, über den Bolzplatz. Ich bin kein guter Fußballspieler, ich habe Angst vor dem harten Ball, aber das fällt nicht weiter auf, es gibt genug Luschen in unsere Mannschaft.
Und dann gibt es noch einen Friseurladen im Dorf. Und der Friseur bin ich. Ich habe das zwar nicht gelernt. Aber ich kann es, und es macht mir Spaß. Die ersten Haare, die ich schnitt, waren die langen braunen meiner Mutter. Ich war dreizehn. Eines Mittags kurz nach halb drei, nachdem ich hundert mal mit der Bürste durch ihr knisterndes Haar gefahren war, schnippte sie die Asche von ihrer Zigarette, steckte sich die Kippe in den Mundwinkel und ließ die Haarsträhnen zwischen zwei Fingern hindurchgleiten bis zu ihren dünnen Enden. Sie runzelte die Stirn, sah mich an und sagte träge: “Hol die Schere. Die Haarspitzen sind kaputt. Du musst sie abschneiden.“ Ich stand wie versteinert. Ich wollte nicht an meiner Mutter herumschneiden, auch wenn es nur die Haare waren, die ich kürzen sollte. Ich wollte, dass sie blieb, wie sie war. Aber ich hatte keine Wahl. Sie setzte sich breitbeinig hin, stützte die Unterarme auf den Oberschenkeln ab, und ließ den Kopf nach vorne zwischen ihre Beine sinken. So floss ihre braune Haarpracht wie ein schlammiger Wasserfall vom Kopf hinunter zum Boden. Sie befahl mir, die Haare zu bündeln, wie einen wilden Wiesenstrauß, und dann die Enden zu kürzen. Ich tat es und biss mir dabei auf die Lippen. Beim zweiten Mal fiel es mir schon leichter, und irgendwann konnte ich den Zeitpunkt nicht mehr erwarten, bis wieder Haarschneidetag war. Ich hatte eine neue Technik entwickelt. Ich machte die Bürste nass und fuhr so lange durch das Haar, bis die Spitzen nass und dunkel auf der Haut ihres Rückens klebten. Dann nahm ich die Schere und mein Lineal, legte das Lineal sehr gerade auf den Rücken meiner Mutter bis zu der Stelle, an der ich das Haar kürzen wollte und schnitt mit der Schere knapp unter dem Lineal entlang eine saubere gerade Linie. Meine Mutter war sehr zufrieden und bald durfte ich auch Oma Gerti die Haare schneiden, und auf große rosafarbene Lockenwickler drehen. Irgendwann probierte ich an Omas Kopf die erste Haarfärbung aus. Danach lief sie eine Zeit mit einem grünen Schimmer in ihren Locken herum. Ich bekam immer ein wenig Geld von Oma, wenn ich ihr die Haare machte. Tante Annemie hingegen war geizig und sie zierte sich lange, bevor ich ihr dünnes Haar schneiden und auf große Wickler drehen durfte. Geld bekam ich von ihr nie. Nachdem ich meine Arbeit auf ihrem Kopf beendet hatte, stand sie stets vor der Frisierkommode meiner Mutter, drehte den Kopf von links nach rechts, sagte gequält „NajaNaja“ und lächelte so, als würde sie sich vor dem Bild ekeln, was sie im Spiegel sehen musste. Dann atmete sie tief ein, wobei sie die Schultern hochzog, und sagte trocken: “Ist schon gut Junge.“ Ein Danke kam nie über ihre Lippen.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Vom Essen und Lieben»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Vom Essen und Lieben» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Vom Essen und Lieben» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.