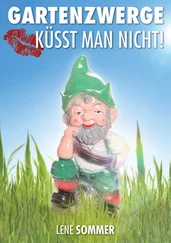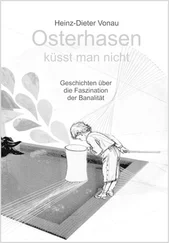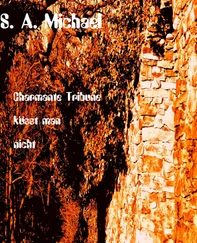Später hat er es mir übrigens mit gleicher Münze heimgezahlt. Ich kam zurück von meiner Freundin Annika. Wir hatten den Nachmittag vor dem Spiegel herumexperimentiert. Als Erstes hatten wir uns die Haare getönt. Ich habe von Natur aus rotblonde Haare, und nach dem Tönen sahen sie fast rot aus. Meine blauen Augen wirkten noch blauer durch meinen veilchenblauen Lidschatten. Wir hatten an nichts gespart und außerdem großzügig Lidstrich, Wimperntusche, Rouge und Lippenstift aufgetragen. Ich fand, ich sah toll aus.
Als ich reinkam, tat mein Stiefbruder, als wäre er wer weiß wie geschockt. Er schrie auf, hielt sich die Augen zu und stöhnte: „Du siehst aus, als wolltest du im Zirkus auftreten. Als Clown.“
„Das ist tatsächlich ein bisschen zu viel des Guten, Merle“, meinte Mama.
Stefan hielt sich raus, aber ich sah an seinem Blick, dass er ihr zustimmte.
Die Eltern konnte ich schlecht anfahren. Also ließ ich meinen Ärger an Dominik aus. „Du findest sicher ungeschminkte Augen hinter Brillengläsern schöner“, zischte ich. Das war gemein von mir, aber ich sagte es trotzdem.
Dominik ließ sich nichts anmerken. „Allerdings“, erwiderte er ruhig.
Viele passende Erwiderungen schossen mir durch den Kopf. „Halt’s Maul, Brillenschlange!“ Oder: „Du hast doch gar keine Ahnung, du Idiot. Stinkstiefel! Arschloch!“ All das fasste ich zusammen in dem Satz: „Du bist echt ätzend!“
„Blöde Kuh!“
Mama fuhr dazwischen: „Kinder, streitet euch nicht.“
Kinder! Wir guckten uns an. Dominik zuckte andeutungsweise die Achseln – seine Lieblingsgeste.
Doch dieser winzige Moment des Einverständnisses war schnell vorbei, als er hinzufügte: „Am besten redet man gar nicht mit der.“
„Diese Bemerkung ist ebenfalls unpassend“, sagte Stefan missbilligend.
Aber Dominik setzte noch einen drauf: „Am besten redet man überhaupt nicht. Mit niemandem.“ Damit ging er raus.
Ich habe das Make-up übrigens danach nicht abgewaschen, aus Prinzip nicht. Den Rest des Abends lief ich damit rum, aber ich fühlte mich äußerst unwohl damit. Jedes Mal, wenn Dominiks Blick auf mich fiel, grinste er. Und an diesem Abend fiel sein Blick oft auf mich. Aus purer Bosheit, vermutete ich, wo er mich doch sonst kaum beachtete!
Bei der Hochzeit unserer Eltern beachtete er mich ebenfalls nicht. Genauso wenig wie er Notiz von den anderen Gästen nahm. Mit mürrischem Gesicht stand er herum. Sein Vater winkte ihn zu sich und bot ihm ein Stück Torte an. Dominik lehnte ab. Das passte zu ihm. Er sagte zu fast allem Nein. „Ob man mit dem überhaupt zusammenleben kann?“, fragte ich mich. Mir war klar, dass es schwierig werden würde. Aber es half nichts, da musste ich durch. Zum Glück würde ich ihn nur ein Jahr ertragen müssen, weil er im Sommer darauf Abitur machen und von zu Hause fortgehen würde.
„Zu Hause ...“ Ich seufzte. Bei diesem Wort dachte ich immer noch an die kleine Dreizimmerwohnung, in der ich mit Mama gelebt hatte. Zehn Jahre lang. Wir waren eingezogen, als ich vier war. Ich erinnere mich noch dunkel daran. Als ich aufs Gymnasium kam, kriegte ich neue Möbel. Die habe ich übrigens immer noch. Sie stehen jetzt in Stefans Haus.
Die Hochzeitsfeier schien kein Ende zu nehmen. War das öde! Wenn Dominik nicht wieder verschwunden wäre, hätte ich mich aus lauter Langeweile vielleicht sogar mit ihm unterhalten. Oder auch nicht. Er machte keinen Hehl daraus, dass er keinerlei Wert auf meine Gesellschaft legte. Ich auf seine auch nicht. Dieses Fest war eine Ausnahme, denn er war der einzige Anwesende, der ungefähr mein Alter hatte. Na ja, das stimmte nicht ganz. Er war schon achtzehn, also vier Jahre älter als ich.
Ich wartete ungeduldig darauf, dass Oma und Opa sich verabschiedeten, damit ich ebenfalls gehen konnte. Während Mama und Stefan auf Hochzeitsreise waren, sollte ich bei ihnen wohnen. Ich hätte auch allein zu Hause bleiben können – in dem neuen Zuhause – aber das wollte ich nicht. Es war mir noch alles zu fremd dort. Außerdem war es zu weit weg von Annika. Wir hatten seit einer Woche Sommerferien und wollten uns jeden Tag treffen.
Annika fand Dominik übrigens toll. Sie beneidete mich richtig um meinen Stiefbruder. Wie die anderen Mädchen in meiner Jahrgangsstufe. Dominik war so etwas wie ein Schulschwarm. Da konnte ich ihnen hundertmal erklären, wie nervig der war, das brachte sie nicht von ihrer Meinung ab.
Dominik wollte in den Ferien wegfahren. Zum Zelten mit seinem Freund Thomas oder so. Ich wusste es nicht genau. Zwar hatte ich ihn gefragt, aber er geruhte nicht, seine Pläne mit mir zu teilen, und murmelte nur etwas Unverständliches in seinen nicht vorhandenen Bart, bevor er mich stehen ließ.
Endlich! Die Hochzeitsfeier neigte sich ihrem Ende zu. Die ersten Gäste brachen auf. Dominiks Tante Maria und Onkel Josef (sie heißen tatsächlich so) kamen zu mir rüber, um auf Wiedersehen zu sagen.
„Du freust dich sicher, dass du jetzt eine richtige Familie hast“, meinte Tante Maria.
„Ja“, erwiderte ich automatisch. Was sollte man auch sonst darauf antworten?
Als sie weg waren, überlegte ich. War ich wenigstens ein bisschen froh darüber, dass wir jetzt mit den Graus zusammenlebten? Mama war glücklich, das merkte ich deutlich, und das freute mich natürlich. Stefan mochte ich gern und er mich auch. Das einzige Problem war dieser Dominik. Der, das ahnte ich bereits, würde mir das Leben zur Hölle machen.
Die Ferien waren vorbei und langsam kehrte in unsere Patchworkfamilie der Alltag ein.
Mein Stiefbruder – mein blöder Stiefbruder, wie ich ihn damals in Gedanken immer nannte – hatte sich nicht gebessert. Er stieß alle laufend vor den Kopf. Wie zum Beispiel an jenem Abend.
Wir setzten uns zum Essen an den Tisch. Auf das tägliche, gemeinsame Abendessen legten die Eltern großen Wert. Nur einer erschien nicht – Dominik. Man merkte Stefan deutlich an, wie sehr ihn das ärgerte. Er stand vom Tisch auf und rief „Dominik!“ durchs Haus mit seiner Lehrerstimme, die er immer hatte, wenn ihm etwas an seinem Sohn nicht passte.
Nichts rührte sich.
Wir fingen an zu essen. Als wir fast fertig waren, hörte man die Haustür klappen und Dominik die Treppe hinaufspringen. Er nahm mehrere Stufen auf einmal.
Stefan warf seine Serviette auf den Tisch. „Dominik!“ Seine Lehrerstimme klang nun richtiggehend wütend.
„Ja?“, schrie der von oben.
„Komm sofort hierher!“
Gemessene Schritte näherten sich.
Stefan erwartete seinen Sohn an der Tür. „Wo kommst du her?“, fuhr er ihn an.
„Von Thomas.“
„Du könntest ein Mindestmaß an Höflichkeit bewahren und wenigstens guten Tag sagen, wenn du dich schon verspätest.“
„Guten Tag“, erwiderte Dominik ungerührt.
Ich unterdrückte ein Grinsen. „Typisch Lehrer“, dachte ich. „Aber Dominik hat gut pariert.“
„Lass es gut sein, Stefan“, mischte Mama sich ein. „Willst du einen Teller Gulaschsuppe, Dominik?“
„Nein! – Danke“, fügte er nach einem Atemzug hinzu.
Stefan blieb weiterhin im Lehrermodus. „Jeden Abend dasselbe“, schimpfte er. „Du kommst zu spät oder du erscheinst gar nicht, ohne uns vorher Bescheid zu sagen, und obwohl wir abgemacht haben ...“
„Moment!“, unterbrach ihn Dominik. „Ihr habt das abgemacht. Nicht ich.“
„Der Ärmste“, dachte ich mit einem Anflug von Mitleid. „Er muss sich doch saudämlich vorkommen, wie er hier vor versammelter Mannschaft von seinem Vater zur Schnecke gemacht wird.“
„Ich finde es nicht schlimm, wenn er nicht mit uns zu Abend isst“, warf ich ein. Und das sagte ich nicht nur, um ihm beizuspringen. Das war meine ehrliche Meinung.
„So? Du findest es nicht schlimm, wenn deine Mutter umsonst für meinen Herrn Sohn kocht?“
Читать дальше