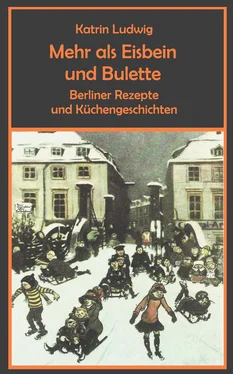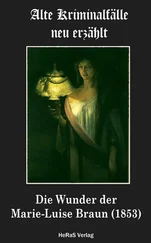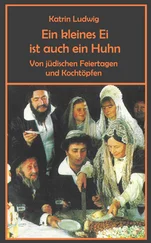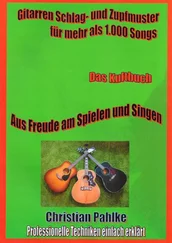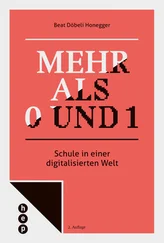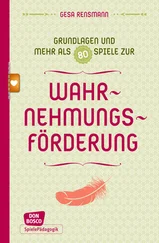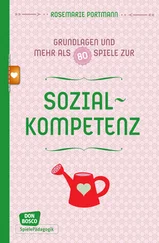Man kehrte zurück zu dem guten alten Brauch, die Männlein und Weiblein züchtig voneinander zu trennen, und Taufen und Hochzeiten mussten genügen für ein »gemeinsames« Vergnügen.
Die Unmäßigkeit von Essen und Trinken riefen eine Reihe von Gesetzgebungen auf den Plan, die mit erheblichen Strafen verbunden waren.
Den Woll- und Leinewebern, die ihr Hemd und ihre Hose vertranken, drohten körperliche und finanzielle Züchtigungen.
1335 wurde per Gesetz ein Gaststättenschluss verfügt: Im Winter nach 21 Uhr und im Sommer nach 22 Uhr durfte sich niemand mehr in den Bier- und Trinkstuben aufhalten.
1399 wurde derjenige in Strafe genommen, der in der Gewerksversammlung der Altflicker so viel aß, dass er sich schließlich übergeben musste.
Am fatalsten jedoch waren die sogenannten »Narrenkisten«. Das waren vergitterte Käfige- vor dem Bernauischen Bierkeller in Berlin und dem Gertraudenthor in Cölln, in dem Betrunkene ihren Rausch ausschliefen. Die Straßenjugend weckte sie des Morgens mit Pfiffen und Spottreden.
Darin sind sich die Jahrhunderte nun wohl gleich geblieben. Der Kater am Morgen in der Narrenkiste oder auf der Bahnhofsbank ist immer noch die gleiche unliebsame und verspottete Erscheinung, wenngleich sie heute bedauerlicherweise schon eher eine Alltagserscheinung geworden ist.
Mit den niederländischen Emigranten, die in Berlin und Umgebung eine neue Heimat fanden, kamen auch neue Gewerke ins Land: Tuchmacher, Färber, Weber, Schnapsbrenner.
Ein Industriezweig partizipierte besonders davon: die Branntweinbrennerei.
Nicht, dass man ihn bis dato nicht gekannt hätte. Aber er galt doch eher als Medikament, erhältlich in den Apotheken, ein Mittel zur Erwärmung, getrunken in kleinen Quantitäten.
Erstaunliche Wirkungen wurden dem Branntwein nachgesagt in dem 1483 erschienenen Verzeichnis.
»Der Branntwein ist gut für die Gicht, damit bestrichen.
Wer heiser ist, der bestreiche sich mit gebranntem Wein den Hals und trinke ihn drei Morgen nüchtern.
Auch wer alle Morgen trinkt einen halben Löffel voll gebrannten Weins, der wird nimmer krank.
Item, wenn eins sterben soll, so gieße man ihm ein wenig gebrannten Wein in den Mund, so wird er reden vor seinem Tod.
Welcher Mensch den Stein in der Blase hat, der trinke ihn alle Morgen ein wenig, das zerbricht den Stein und kommt von ihm und wird gesund.
Auch wer gebrannten Wein trinkt alle Monat, so stirbt der Wurm, so da wächst dem Menschen an dem Herzen, an der Lunge oder Leber.«
Die Breitenwirkung des wohltätigen Branntweins ist groß.
Gegen Kopfschmerzen, Gedächtnisstörungen, für Sinn und Witz, gegen Läuse und Milben; und »wem der Athem stinket, der bestreiche sich damit und trinke ein wenig mit anderem Wein, so wird ihm ein süßer Athem«.
Kein Zweifel- die Berliner waren schnell überzeugt, und gegen Ende des 16. Jahrhunderts legten sie sich mit der Branntweinherstellung so mächtig ins Zeug, dass 1595 der Blasenzins, erhoben vom Magistrat, zu einer einträglichen Steuer wurde.
Die Berliner brannten nicht mit Korn, sondern mit schlechtem oder verdorbenem Wein, taten dies aber mit solchem Eifer, dass der Weinanbau im Umland beträchtlichen Schaden nahm und nach und nach einging.
Leibliche Genüsse, von den Hugenotten nach Berlin und in die Mark getragen, fanden ebenso Aufnahme bei Hofe, wie in den Bürgerhäusern und beim Volk.
Kaffee und Schokolade wurden schnell angenommen, gepflegt und geliebt.
Der Tabak hatte es da etwas schwerer zu Anfang. Nicht, dass er sich zu langsam durchsetzte. Das ganze Gegenteil war der Fall. Der Tabak fand so schnell seine Verehrer und vor allem seine Verbraucher, dass die Kirche auf den Plan trat und den Tabak disqualifizierte als »ein Vorspiel des Höllenfeuers«.
Zugleich war jedoch ersichtlich, dass der Tabak eine gewinnbringende Einnahme für den Staat sein würde. Wir würden es heute Monopolbildung nennen, was der jüdische Händler Hartwich Daniel betrieb. Er belieferte nämlich als »Privilegium« die Alt-, Mittel- und Uckermark sowie die Prignitzer und Ruppinschen Kreise und setzte dabei jährlich Tabak im Werte von 100.000 Talern um.
Auch Friedrich II., der Alte Fritz, machte es nicht viel anders.
1766 wird das Monopol für die Einfuhr von Rauch- und Schnupftabak von der kgl. Generaltabakadministration übernommen; das bringt dem Staat jährlich über eine Million Taler an Mehreinnahmen. 1787 wird diese »Regie« wieder aufgehoben, und eine allgemeine Steuererhöhung auf Lebensmittel erhöht die Staatseinkünfte.
Der Alte Fritz hat gern geschnupft. Seine als Muschel geformte Tabakdose beweist es.
Waren die Städter schnell bei der Hand, wenn es um leibliche Vergnügungen ging, verhielt sich die Landbevölkerung doch misstrauischer und war eher geneigt, den Warnungen der Kirche zu folgen. Unter dem Großen Kurfürst war auf dem Lande das Rauchen sogar gänzlich unbekannt.
Folgende Anekdote ist überliefert:
Der Große Kurfürst nahm seinen Kammerdiener, einen Mohren, auch zur Jagd mit sich. Dieser machte sich den Spaß, einem märkischen Treiber, einem Bauern, ein angerauchtes Pfeifchen anzubieten.
Der Bauer lehnte entsetzt ab mit den Worten: »Nein, gnädiger Herr Teufel. Ich esse kein Feuer!«
Da es um Tabak geht, soll auch vom Tabakkollegium des Soldatenkönigs, Friedrich Wilhelm I., erzählt sein.
Winters um 17 Uhr und Sommers um 19 Uhr versammelte sich im Schloss eine kleine Gesellschaft, nie mehr als acht Personen. Es waren dies Generäle und Stabsoffiziere des königlichen Gefolges, zuweilen auch Reisende oder Gelehrte oder Leute »außerhalb von Rang und Namen«. Führte der König sein Tabakkollegium in Wusterhausen durch, lud er auch den Dorfschulmeister dazu, der ihm, ob seiner außerordentlichen Strenge mit den Schülern, sehr zusagte.
Die Gäste erwarteten den König im Schlosssaal, und pünktlich betrat der König den Raum, ohne dass sich die Gäste ehrerbietig erhoben oder ihn begrüßten.
Der König und seine Gäste benutzten kurze holländische Tabakspfeifen, geraucht wurde holländischer Tabak, weil er billig war, nicht so teuer wie der amerikanische. Dem König gefiel es gar nicht, wenn einer der Gäste eigenen Tabak mitbrachte. Jeder der Gäste musste zumindest eine Pfeife rauchen oder sie im Mund haben.
Erzählt wird auch, dass der alte Dessauer, Fürst Leopold v. Dessau, das Rauchen nun gar nicht vertrug, aber doch ein stets geladener Gast war. So hielt er die kalte Pfeife solange im Munde, bis das Kollegium vorbei war. Ebenso Graf von Seckendorf; der tat sogar, als rauchte er und blies imaginäre Tabakwolken von sich, um seinem König zu gefallen.
Getrunken wurde eine halbe Tonne Bier, gegessen wurde Brot, Butter, Käse und Braten, und war der König gut gelaunt, bereitete er seinen Gästen einen Salat. Für die Innen- und Außenpolitik Preußens waren die Runden des Tabakkollegiums von großer Bedeutung, und sie hatten den Ruf, zuweilen gnadenlos zu sein, wenn die Witze und die Späße auf Kosten einzelner Personen gingen.
Friedrich Wilhelm hatte dafür eigens die sogenannten »wissenschaftlichen Hofnarren« erfunden. Das waren Professoren, der fremden Sprache mächtig, die ihm aus den Zeitungen vorlasen, wenn es an der Unterhaltung gebrach. Es war ein trauriges und gefährliches Amt, das ihnen da zugefallen war, denn der Zorn des Königs, den eine Zeitungsnotiz hervorrief, richtete sich gegen den Vortragenden.
Kaffee, Schokolade, Tabak hatten die Berliner im Sturm erobert, mit dem Tee hingegen ging das langsamer vonstatten. Er galt lange als ein medizinisches Getränk. Dafür sorgte auch der kurfürstliche Leibarzt Cornelius Bontekoe, der, von den Holländern mit einem guten Gehalt ausgestattet, für die Einführung des Tees in Deutschland sorgte und ihn als Universalmittel für Krankheiten jeglicher Art einsetzte.
Читать дальше