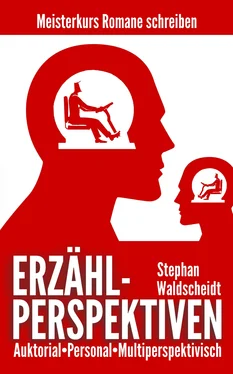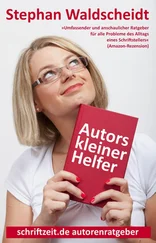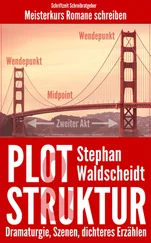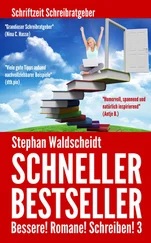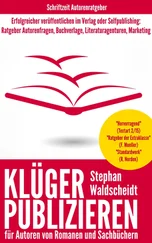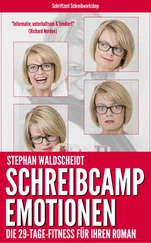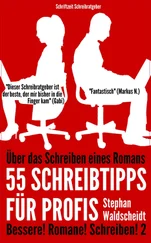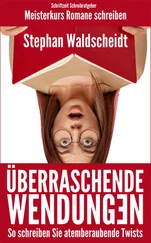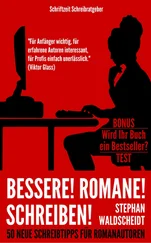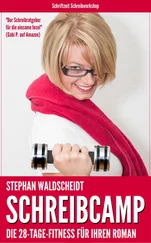…«
(Anne Freytag, »Mein bester letzter Sommer«, Heyne fliegt 2016)
Die größte Gefahr distanzierten Erzählensist, dass Sie damit das Leben aus Ihrer Geschichte lassen, sodass die Farben blasser werden, die Geschmäcke schaler – und vor allem: dass die Charaktere den Lesern egal bleiben.
Ein absolutes Richtig und Falsch gibt es auch bei der Frage nach Nähe und Distanz nicht. Doch wenn Sie wissen, was Sie da schreiberisch tun und wo die Risiken lauern, sind die Chancen größer, dass Sie eine gute Entscheidung treffen und ein für Ihre Zielgruppe bekömmliches Maß an Emotionen und Nähefinden.
Wie etwa das John Grisham seit Jahrzehnten wieder und wieder schafft, weltweit. In seinem Roman »Die Bruderschaft« wird seinen Lesern die Geschichte aus den Perspektiven von mehr als zehn Charakteren nahegebracht. Nicht einer dieser Charaktere hat eine bemerkenswerte Stimme, keiner ist besonders sympathisch oder bemerkenswert. Trotzdem beschert der Roman seinen Lesern gute Unterhaltung, die weder flach noch banal daherkommt.
Denn Grisham weiß, für wen er schreibt. Zugleich hat er sich seine zu Fans gewordenen Leser über die Jahre erzogen und auf seine Linie gebracht. Wer Grisham liest, sucht nicht das emotional berührende Erlebnis, seine Leser brauchen keine Identifikationsfigur, um den Roman zu genießen. Für Grisham-Leser steht, nicht nur in »Die Bruderschaft«, der Plot im Mittelpunkt. Der Genuss ist eher ein intellektueller als ein emotionaler, eher ein breiter als ein tiefer, sie suchen keine Geschichte, die lange nach dem Schließen des Buchs in ihnen nachwirkt, sie suchen die Lektüre für den Strand, die Hotellobby und zum Einschlafen, für die paar Seiten Lesen zwischendurch, sie suchen keine Bindungen an die Figuren, möchten aber doch intelligent unterhalten werden.
Wobei wir mit »Leser« grundsätzlich nicht die Person meinen, sondern die Lese-Rolle. Denn die meisten Leser nehmen unterschiedliche Rollen ein, wollen mal flott unterhalten, mal tief bewegt werden, mal lachen und sich mal vor Spannung die Nägel abkauen.
Mit richtig oder falsch hat diese Entscheidung der Leser so wenig zu tun wie mit anspruchsvoller und anspruchsloser Lektüre oder mit guter oder schlechter Literatur. Es geht eben nicht nur darum, effektiv Nähe oder Distanz herzustellen – sondern das richtige Maß zu kennen und im Roman zu realisieren. Für wen also schreiben Sie ?
Haben Sie das passende Maß für Ihre Leser ermittelt oder festgelegt, geht es nun darum, Nähe oder Distanz in der gewählten Perspektive von Anfang bis Ende durchzuhalten. Davon abweichen sollten Sie nur zweckgerichtet, etwa beim Einzoomen oder bei Kommentaren des Erzählers.
Zoom
Reden wir von Heran- oder Herauszoomen, verstehen wir darunter grundsätzlich einen Wechsel der Distanz innerhalb derselben Perspektive. Zoomen nach diesem Verständnis erfordert oder begründet also keinen Perspektivwechsel.
Bieten Sie Ihren Lesern auf den ersten hundert Seiten einen flotten, distanziert personalen Roman, der sich an ein plot-orientiertes Publikum richtet, sollten Sie nicht den Rest des Romans versuchen, den Lesern mit einem intimen POV auf die Emotionspelle zu rücken. Umgekehrt werden Sie Ihre Leser verstören und aus dem Roman treiben, wenn Sie nach zweihundert Seiten einer nahen Ich-Perspektive zu einer distanziert-ironischen Erzählweise wechseln.
Behalten Sie eins im Hinterkopf: Zu den Fragen nach der Nähe der Leser zu Charakteren, Story und Thema gehört eine weitere, die bei allem mitschwingt: Wie nahe holen oder lassen Sie die Leser an sich selbst heran?
So stellen Sie Nähe oder Distanz her
Nähe zwischen Leser und Figur stellen Sie mit erzählerischen Mitteln am leichtesten und effektivsten genau in dem Moment her, in dem Sie eine Figur einführen. Fast immer funktioniert es, den Lesern einen Charakter vorzustellen, der ihnen in wichtigen Aspekten ähnelt oder Erfahrungen mit ihnen teilt.
Ähnlichkeiten können sich in der Persönlichkeit finden, in den Lebensumständen oder in Situationen, die dem Leser vertraut sind, wie eine Unterhaltung am Küchentisch, das Stehen im Stau, die unglaubliche Verbohrtheit der Eltern beim Thema Musik und deren Lautstärke.
Am meisten Leser erreichen Sie, klar, mit sehr allgemeinen Dingen wie dem Geschlecht oder der Herkunft. Bei den Erfahrungen sorgen Banalitäten (Klischeewarnung!) wie das verstörende Klingeln des Telefons mitten in der Nacht für Nähe: Ein Anruf um diese Zeit bedeutet nichts Gutes! Auch hier entscheidend: Wer ist Ihre Zielgruppe?
Besonders nahe heran holen Sie Leser mit tief in ihrer Psyche verankerten Dingen. So kennen die meisten das Gefühl, jemanden nicht wert oder für etwas nicht gut genug zu sein – mangelnder Selbstwert oder das Gefühl, nicht dazuzugehören. Sobald Sie diese universellen Emotionen angraben, sind die Leser bei Ihren Figuren. Wie das im Folgenden Joe Hill tut. Seine Protagonistin Vic denkt:
»…
Sie wünschte, sie wäre sich der großen Kluft zwischen dem Wert, den die Männer in ihrem Leben ihr zuschrieben, und ihrem tatsächlichen Wert nicht dermaßen bewusst. Sie hatte, so schien es ihr, immer zu viel verlangt und erwartet und zu wenig gegeben. Beinahe schien sie einen perversen Drang zu haben, es jeden bedauern zu lassen, der sich um sie sorgte, und genau die eine Sache zu finden, die diese Menschen am meisten abschrecken würde – und das dann so lange zu tun, bis diese Menschen aus purer Selbsterhaltung weglaufen mussten .
…«
(Joe Hill, »N0S4A2«, Gollancz 2013, eigene Übersetzung)
Haben Sie in einem ersten Schritt Sympathie für den Charakter erzeugt, können Sie in einem nächsten spezifischer werden und sich damit von den Lesern wegbewegen.
Nehmen wir an, Sie haben eine weibliche Hauptfigur aus Deutschland vorgestellt. Auf diese Weise liefern Sie der Mehrzahl der Leser Vertrautes. Sofern die Erzählstimme ebenfalls ankommt, stehen die Chancen auf eine Grundsympathie bestens. Als Nächstes enthüllen Sie die Leidenschaft des POV-Charakters für texanische Bluegrass-Musik, für viele Leser etwas Fremdes. Aber, und hier hilft Ihnen die Psychologie, weil die Romanfigur der deutschen Leserin da schon sympathisch ist, wirkt auch der eigentlich fremde Musikgeschmack sympathischer. Der umgekehrte Weg – erst die Musikvorliebe, dann die passende Demografie – würde weniger gut funktionieren.
Nicht zuletzt sind es solche Ähnlichkeiten, die sich das Buchmarketingzunutze macht und die mit entscheiden, ob man Ihren Roman veröffentlicht: So bevorzugt man in den Verlagen Protagonistinnen für ein vorwiegend weibliches Genre-Publikum. Auch Regiokrimisstellen auf vergleichbare Weise Nähe her: Indem sie ihren Lesern eine vertraute Umgebung zeigen, gleichen sie die Lebensumstände des Protagonisten denen ihrer angestrebten Leserschaft an.
Die Ich-Erzählerin im nächsten Beispiel beschreibt das Gefühl von Musik aus Kopfhörern, das sich für jeden aus der Zielgruppe dieses Jugendbuchs sattsam bekannt anfühlt – und für Nähe sorgt:
»…
Die großen Kopfhörer liegen weich auf meinen Ohren und verschlucken die Außenwelt. Sie sind wie ein Verstärker, ein Mikroskop für mein Innenleben. Ich höre nur noch meinen rasenden Puls und meinen flachen Atem, die sich mit dem Klang der Musik vermischen. Das bin nicht ich. Dieses starrende Wesen, das die Augen nicht von ihm losreißen kann. Die mit den zitternden Fingern und den weichen Knien. Meine Hände umklammern noch immer das Buch, in dem ich vor ein paar Sekunden gelesen habe – als ich noch ich war und die Geschichte fesselnd. Hör endlich auf, ihn anzustarren. Komm schon, Tessa, schau weg. Aber ich kann nicht. Weder wegsehen noch denken. Als wäre mein Verstand zu Boden gegangen und ich gefangen in einem fremden Körper, der herrlich seltsame Dinge tut. Meine Fingerkuppen sind taub, meine Hände eiskalt und mein Magen fährt Karussell.
Читать дальше