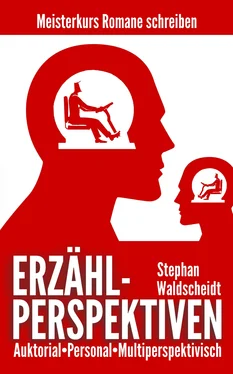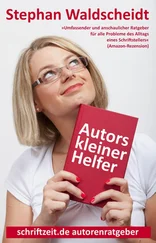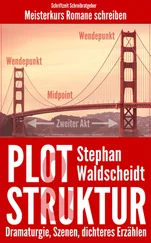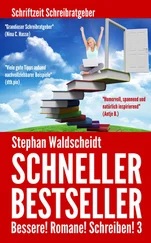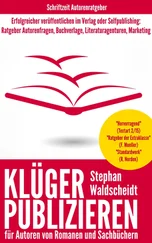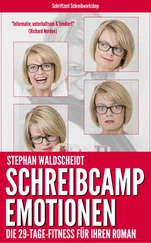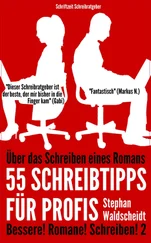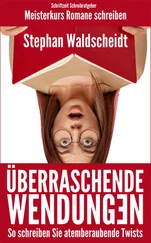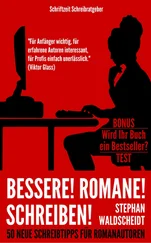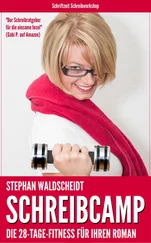Sie griff nach dem Schürhaken am Kamin.
…«
(Charlotte Jacobi, »Sehnsucht nach der Villa am Elbstrand«, Piper 2019)
Auch die natürliche Abfolge von Gedanken oder Handlungen sorgt, sofern eingehalten, für größere Nähe. Das geschieht oben in den ersten Sätzen: Das Gefühl, nicht allein zu sein, kommt als Erstes. Danach, ganz natürlich, die Folgerung: Sie wird beobachtet, dann die natürliche Folgerung daraus: Jemand ist bei ihr im Raum. Damit nimmt das Autorenduo Charlotte Jacobi die Leser nahe an Sofie heran.
Das ist weniger banal, als es zunächst erscheint. Sehen wir mal davon ab, dass leider nicht jeder Autor mit einem Sinn für Logik gesegnet ist[Fußnote 18] , so kann bei Ergänzungen und vor allem bei der Überarbeitung solcher Abfolgen leicht etwas unter den Tisch fallen oder durcheinandergeraten.
Im Beispiel folgen, nach Sofies vergeblichen Rufen, sehr viele vernünftige Erwägungen. Vielleicht zu viele. Obwohl die logische und natürliche Reihenfolge beibehalten wird – die Folgerungen sind schlüssig –, wirken die Gedanken auf manchen Leser möglicherweise zu sehr vernunftgesteuert, dauert es zu lange, bis Sofie zum Schürhaken greift. Grundkenntnisse in Wahrnehmungspsychologiehelfen mit, solche Szenen den Lesern so nahe wie möglich zu bringen, Gefühle sind schneller als rationale Gedanken.
Urteilen Sie selbst: Wirkt die originale Szene oben näher oder die gekürzte unten?
Plötzlich hatte sie das Gefühl, dass sie beobachtet wurde. Jemand war hier! Sofie erschauderte. Ein Knarzen auf dem Holzboden hinter ihr bestätigte das Gefühl. Sie fuhr herum.
»Ist da wer?«, rief sie. »Max?«
Keine Antwort. Ihr Blick flog zur Remise, wo ihr Mann an seinem Landauer werkelte. Außer Rufweite. Er konnte ihr nicht helfen.
Sie griff nach dem Schürhaken am Kamin.
Gerade in handlungsreichen, flotten Szenen hält umständliche Prosa mit überflüssigen Wiederholungen die Leser auf Abstand. Für die Leser fühlt es sich an, als müssten sie sich erst durch die Sätze kämpfen, bevor sie in die Situation hineindürfen.
Wieso aber funktioniert eine Dehnung der Zeit so gut, wenn Sie in einer Szene wie oben Spannung erzeugen möchten? Das klappt, sofern der Text möglichst konkret bleibt, natürliche/logische Abfolgen einhält, auf Redundanzen verzichtet und sich reibungslos liest.
Dass Ihnen mit einem personalen Erzähler Nähe leichter und natürlicher gelingt, liegt auch daran, dass ein solcher Erzähler zuvörderst eine Person Ihres Roman-Ensembles ist und erst danach ein Erzähler[Fußnote 19] . Möchten Sie die Leser eng bei diesem Charakter halten, so stellen Sie dieses Personale immer wieder klar heraus.
Eine von unzähligen Möglichkeiten dazu zeigt uns Stefan Kiesbye mit einer Stelle, die wir schon kennengelernt haben:
»…
Das Gebäude war größer als unsere Schule, größer noch als unsere Kirche, und die Ziegel waren gelb gestrichen. Und ganz so, als ob wir hohe Herren wären, wurden wir zum Vordereingang hinaufgefahren. Der Fahrer stieg aus und öffnete uns die Türen.
An der Treppe wurden wir von einer alten Frau in einer Dienstmädchenuniform begrüßt, die uns versicherte, dass unsere Gastgeber sich bald zu uns gesellen würden. Sie führte uns die Stufen zum Eingang hinauf, dessen Flügeltüren höher als das Haus meiner Eltern schienen. Von der Eingangshalle geleitete sie uns in einen Raum, der wohl als Wartezimmer diente. Meine drei Brüder hätten einander auf die Schultern klettern können, ohne die Decke zu berühren, und das Zimmer war vier- oder fünfmal so groß wie die gute Stube meiner Eltern.
…«
(Stefan Kiesbye, »Hemmersmoor«, Tropen 2011)
An mehreren Stellen bezieht Kiesbyes personaler Erzähler das Beschriebene auf sich und das, was er kennt: »größer als unsere Schule, größer noch als unsere Kirche«, »Flügeltüren höher als das Haus meiner Eltern«, »Meine drei Brüder hätten einander auf die Schultern klettern können, ohne die Decke zu berühren, und das Zimmer war vier- oder fünfmal so groß wie die gute Stube meiner Eltern.«
Diese Sicht ist so persönlich, dass sie die Leser näher an den Text heranholt und das Gesagte glaubhafter macht.
Ein Mittel zum Variieren der Distanz ist die Erzählzeit, das Tempus. Je aktueller die geschilderten Ereignisse sind, sprich: je näher am Präsens sie erzählt werden, desto näher sind ihnen die Leser.
Das Präsens ist das Tempus, mit dem sich grundsätzlich die größte Nähe, weil größte Unmittelbarkeit, dar- und herstellen lässt. Der Erzähler berichtet, was er just im Augenblick erlebt oder was gerade im Roman vor sich geht. Siehe das Beispiel oben aus Anna Todds Roman. Oder dieses hier:
»…
Auf einmal höre ich hinter mir ein zittriges Einatmen und merke, dass ich nicht allein bin. Ich drehe mich um. Ich sehe nackte Haut und dunkles, graugesprenkeltes Haar. Ein Mann. Sein linker Arm liegt auf der Decke, und am Ringfinger der Hand steckt ein goldener Ring. Ich unterdrücke ein Stöhnen. Der Typ ist also nicht nur alt und grau, denke ich, sondern auch noch verheiratet. Ich habe nicht nur mit einem verheirateten Mann gevögelt, sondern vermutlich noch dazu bei ihm zu Hause, in dem Bett, das er normalerweise mit seiner Frau teilt. Ich sinke zurück, um mich zu sammeln. Ich sollte mich schämen.
Ich frage mich, wo die Ehefrau ist. Muss ich befürchten, dass sie jeden Augenblick hereingeschneit kommt? Ich stelle mir vor, wie sie am anderen Ende des Zimmers steht, kreischt, mich als Schlampe beschimpft. Eine Medusa. Ein Schlangenhaupt. Ich überlege, wie ich mich verteidigen soll, falls sie tatsächlich auftaucht, und ob ich dazu überhaupt imstande bin. Der Typ im Bett wirkt jedoch völlig unbesorgt. Er hat sich auf die andere Seite gerollt und schnarcht weiter.
Ich versuche, ganz still zu liegen. Normalerweise kann ich mich erinnern, wie ich in eine derartige Situation geraten bin, aber heute nicht. Ich muss auf einer Party gewesen sein, in einer Bar oder einem Club. Ich muss ganz schön betrunken gewesen sein. So betrunken, dass ich mich an gar nichts erinnere.
…«
(S. J. Watson, »Ich. Darf. Nicht. Schlafen.«, Scherz 2011)
Der Text zieht die Leser sofort hinein, eine Distanz zwischen ihnen und der Erzählerin scheint nicht zu bestehen – die Kombination der Ich-Perspektive mit dem Präsens sorgt dafür. Je weiter Sie sich vom Präsens entfernen, desto distanzierter wirkt der Text auf die Leser.Grundsätzlich, aber längst nicht immer. Vergleichen Sie:
Lordie zieht ihre Pistole und legt in aller Ruhe an, während um sie die Geschosse einschlagen.
Lordie zog ihre Pistole und legte in aller Ruhe an, während um sie die Geschosse einschlugen.
Welches der Beispiele wirkt auf Sie näher, unmittelbarer? Ohne Kontext (!) wahrscheinlich der Text im Präsens.
Doch auch Rückblenden einer schon im Präteritum erzählten Geschichte entfernen die Leser weiter vom Geschehen. Vergleichen Sie:
Lordie zog ihre Pistole und legte in aller Ruhe an, während um sie die Geschosse einschlugen.
Lordie hatte ihre Pistole gezogen und in aller Ruhe angelegt, während um sie die Geschosse eingeschlagen waren.
Das Entsprechende gilt für Texte im Futur I oder Futur II. Dafür verantwortlich dürfte jedoch nicht allein die Erzählzeit an sich sein, sondern die umständliche Konstruktion über Hilfsverben, die ein Tempus wie das Plusquamperfekt oder das Futur II erfordert.
Distanzierend wirkt zumal ein unklarer Umgang mit der Erzählzeit, also wenn die Leser den Überblick verlieren, ob sie gerade gegenwärtigen, vergangenen oder vorvergangenen Ereignissen beiwohnen.
Читать дальше