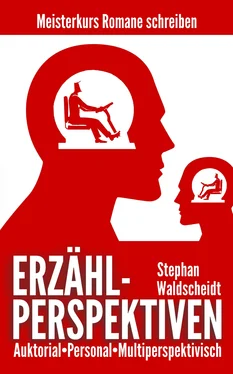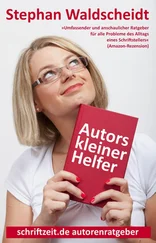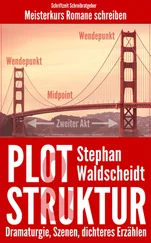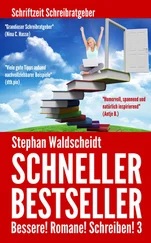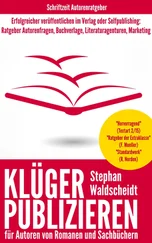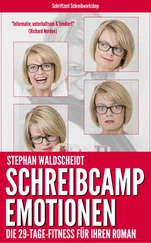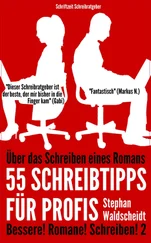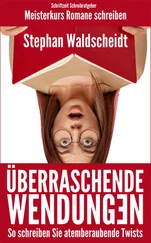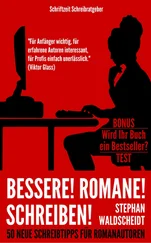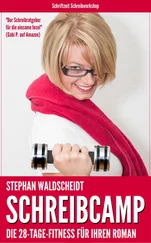Ein weiterer Zweck distanzierten Erzählens kann es sein, Ihrem Text den Anschein von mehr Objektivitätzu verleihen. Etwa wenn Sie ein Geschehen so beschreiben wollen, als wäre es ein offizieller, also automatisch wahrer und nicht-tendenziöser Bericht. Insbesondere phantastischen oder schwer fassbaren Geschehnissen verleihen Sie damit die notwendige Glaubwürdigkeit. Ironischerweise sorgt dann das Reportagehafte dafür, dass die Leser dem Geschilderten gegenüber eben nicht neutral bleiben. Stattdessen löst ausgerechnet die empfundene Objektivität und Wahrheit die Emotionen aus.
»…
Die zwei Erzieherinnen erreichten die Stadt am Nachmittag des 25. Juni 2007. Sie kamen mit dem Regionalzug aus Brescia, der um Punkt 17.45 Uhr in den Bahnhof von Bergamo einfuhr.
Später gab es Leute, die behaupteten, ihnen seien die beiden Frauen von Anfang an nicht geheuer gewesen. Altersmäßig trennten sie Jahre, siebenundzwanzig die Jüngere, eben erst geworden, fünfzig die Ältere, und obwohl sie nicht miteinander verwandt waren, nahmen sie sich zusammen eine Wohnung, noch dazu in einem ziemlich verrufenen Viertel.
(…)
Später, als die Anwesenheit der Erzieherinnen schon genug Aufsehen in der Stadt erregt hatte, fand sich eine zweite Zeugin, die Signora Lorenzis Version bestätigen konnte, ja, die sogar willens war, noch eins draufzusetzen.
(…)
Beide Zeugenaussagen können, auch wenn sie in etlichen Punkten übereinstimmen und vermutlich in gutem Glauben abgelegt wurden, als unwahr betrachtet werden.
…«
(Antonio Scurati, »Das Kind, das vom Ende der Welt träumte«, Rowohlt 2010)
Der nüchterne Tonfall wird unter anderem dadurch erreicht, dass (für den Plot unnötig) genaue Orts- und Zeitangaben gemacht werden, zudem findet sich kein Erzähler, also kein Verantwortlicher – typisch für offizielle Dokumente von Beamten.
Zahlensind objektive Angaben und halten die Leser tendenziell mehr auf Distanz. Ein Ich-Erzähler, der die Leser nahe heranholen will, würde also bei der Beschreibung einer neuen Figur nicht schreiben »Sie war einsdreiundsiebzig«, sondern »Sie war so groß, dass ich zum Medaillon an ihrem Hals sprach wie in ein Mikrofon«.
Faustregel
Relationen zum Erzähler sind nah, Absolutes ist fern.
Je konkreter die Relation, desto näher: »Sie war größer als ich« ist distanzierter als der Satz mit dem Medaillon.
Eine Erzählerin, die von einer »nahen Verwandten der Heldin« spricht, hält die Leser auf mehr Abstand, als wenn sie schriebe: »die Mutter der Heldin«. Auch hier wächst die Nähe mit dem Grad an Konkretheit: »Mutter« ist näher als »Verwandte«, »Verwandte« ist näher als »Frau«, »Frau« ist näher als »Mensch«.
Besonders konkret sind sehr spezifische Dinge, die in den Lesern etwas auslösen, am besten eine körperliche Reaktion, etwa der Satz »Henriette presste die Zitrone direkt auf ihrer Zunge aus, jeder Tropfen eine süßsaure Explosion, die ihr die Tränen in die Augen trieb«. Szenen und alles Dynamische sorgen in den Lesern eher für innere Bilder: »Lou rannte, seine Ledersohlen klatschten auf den Asphalt« ist dynamischer als »Bella saß auf dem Sofa«.
Faustregel
Konkretes ist nah, Abstraktes ist fern.
Sie sehen, auch beim distanzierten Erzählen kommt es auf Nuancen an. Weniger gut nämlich funktioniert das Reportagehafte dann, wenn Sie es nicht konsequent betreiben und den Reportage-Stil mit Emotionen oder gar Melodrama aufpeppen wollen. Wie das Marc Ritter tut:
»…
Eine Viertelstunde später war die Nachricht durch die schier endlose Schlange der Wartenden gedrungen und kam auch auf dem Platt im SonnAlpin an. Daraufhin wussten die Menschen, dass es eine lange Zeit dauern würde, bis sie wieder vom Berg hinunterkämen. Allen war bekannt, dass der Tunnel der Zahnradbahn eingebrochen war, und nun war auch die österreichische Seilbahn zerstört worden. Vergeblich versuchten die Wartenden, über ihre Handys und Smartphones weitere Informationen zu erhalten. (…)
Wellen der Angst schwappten durch die Menge. Was würden die Terroristen als Nächstes tun?
…«
(Marc Ritter, »Kreuzzug«, Droemer-Knaur 2014)
Durch emotionale Einsprengsel wie »die schier endlose Schlange der Wartenden« oder »Wellen der Angst« gibt der Text ausgerechnet das auf, was ihn (besser) funktionieren lassen würde. Das Reportagehafte wird so immer wieder vom Autor selbst unterwandert und ein Satz wie »Wellen der Angst schwappten durch die Menge« wirkt dann lediglich behauptet. Mit der Folge, dass gerade diese auf Emotionen zielenden Teile dafür sorgen, dass die Leser nichts empfinden.
(Unberührt bleibt hier, dass dieser Mix aus Fakten und Emotionen womöglich modernem Reportagestil entspricht. Sie sehen: Auch hier gibt es kein absolutes Richtig oder Falsch.)
Erschwerend kommt hinzu, dass weite Teile des Romans von Ritter aus einer (gewollt, aber nicht realisiert) näheren personalen Perspektive geschildert werden als der Auszug oben. Ein solches Hin und Her zwischen nahe und distanziert gehen viele Leser nicht mit, sodass ihnen der Text mal als zu nüchtern, mal als zu emotional erscheint – und beides als künstlich. Im Ergebnis siegt bei Durcheinander und häufigen Distanzwechseln immer die Distanz.
Die indirekte Rededes Konjunktiv I fungiert ebenfalls als Distanzierungsmittel, indem sie die Leser über eine Instanz von der Geschichte wegrückt. Die erzählten Ereignisse werden nur indirekt erlebt. Ihr Wahrheitsgehalt hängt davon ab, als wie vertrauenswürdig und zuverlässig der Erzähler eingestuft wird.
»…
An dieser Stelle nun gebe es in seinen Ausführungen eine kleine Lücke. Er, Kron, könne sich nämlich an keine Einzelheiten des gemeinsamen Weges zum Parkhaus erinnern, woraus er jedoch schließe, dass dieser ereignislos verlaufen sei. Woran er sich hingegen wieder ganz genau erinnere, sei die Uhrzeit, die der Automat beim Einschieben seines Parkscheins angezeigt habe. 16 Uhr 53 habe dort in grünen Leuchtziffern gestanden, auch dies ein Beleg dafür, dass man den Weg vom Krokodil zum Parkhaus zügig zurückgelegt habe. Gemeinsam sei man nun aufs erste Oberdeck gegangen, wo er nach einigem Suchen seinen Wagen in der hinteren rechten Ecke gefunden habe. Auf dem Weg dorthin habe sich allerdings ein Zwischenfall ereignet. Man könne gewiss unterschiedliche Formulierungen dafür finden, aber im Grunde genommen laufe es wohl darauf hinaus: Der Mann habe fliehen wollen.
…«
(Martin Gülich, »Septemberleuchten«, Nagel & Kimche 2009)
Die indirekte Rede erzeugt deshalb Distanz, weil darin über einen Charakter gesprochen wird und nicht der Charakter selbst zu Wort kommt. Ein Erzähler schiebt sich als Instanz zwischen Leser und Charakter. Das gilt unabhängig von der Erzählperspektive, also auch bei der »nahen« Ich-Perspektive. Im direkten Vergleich wird es deutlich:
»Vom Hühnerklauen«, sagte Karin zu mir, »weißt du so wenig wie vom Pferdestehlen.«
Ich grinste.
Karin sagte, ich hätte vom Hühnerklauen so wenig Ahnung wie vom Pferdestehlen. Was ich mit einem Grinsen quittierte.
Distanz erzeugen Sie auch, wenn Sie Funktionswörterzwischen Leser und Ereignisse schieben.
»Das wird schon«, sagte Tanja und rieb sanft über Sonjas Arm.
Wenn Tanja wüsste, was ich und Ben getan haben, dachte Sonja, würde sie ihre Hand da wegreißen wie von einer heißen Herdplatte.
Zu den Übeltätern – nennen wir sie Funktionswörter[Fußnote 22] , weil sie zwar eine Funktion im Text erfüllen, inhaltlich aber nicht von Belang sind – zählen etwa sagte und dachte in Begleitsätzen von Dialogen. Obwohl die Leser sie überlesen, legen sie sich wie ein Puffer zwischen Story und Leser, allein durch ihre Sichtbarkeit auf der Seite und ihre Hörbarkeit durch die innere Stimme des Lesers.
Читать дальше