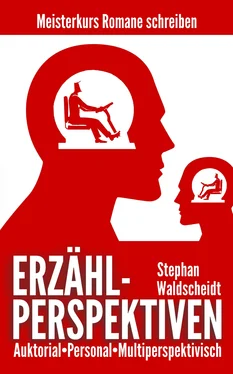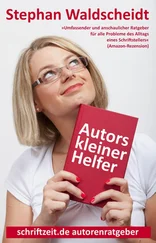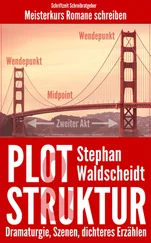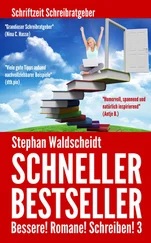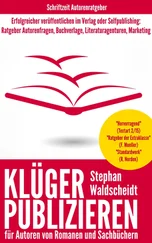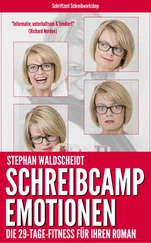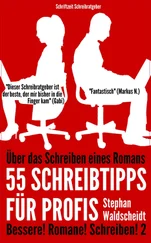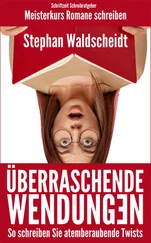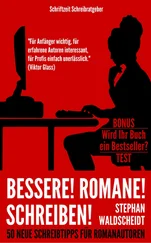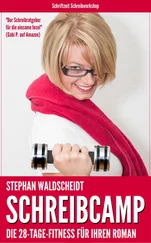Das blöde Heu! Peterchen spürte ein Jucken in der Nase.
Nahe ohne Verb der Wahrnehmung und ohne Namen:
Das blöde Heu! Seine Nase juckte.
Fragen Sie sich stets: Was will ich meinen Lesern zeigen? Sollen Sie in der Figur drinsitzen und wahrnehmen, empfinden, fühlen, was sie wahrnimmt, empfindet, fühlt? Oder möchten Sie, dass sie die Figur von außen betrachten, die sinnlichen Wahrnehmungen und Gefühle also nur indirekt erkennen?
Der Hahn pickte Peterchen in den großen Zeh. Wütend warf Peterchen ihm die ganze Handvoll Körner über.
Hier erzählen Sie den Lesern von Peterchens Gefühlen: seiner Wut auf den ungezogenen Hahn.
Der Hahn pickte Peterchen in den großen Zeh. Peterchen schrie auf und schmiss dem Mistvieh die ganze Handvoll Körner über.
Hier zeigen Sie den Lesern Peterchens Wut. Sein Aufschrei und die Wortwahl – »Mistvieh« – nehmen die Leser mit hinein in Peterchens Gefühlswelt. Damit präsentieren Sie seine Gefühle direkter und holen die Leser näher an Peterchen heran.
Wenn Sie Zeigen und Erzählen unter dem Aspekt Nähe und Distanz betrachten, erkennen Sie auch, dass das eine nicht per se besser ist als das andere: Das Zeigen ist in den meisten Fällen ein Mittel zur Herstellung größerer Nähe zwischen Leser und Figur.Das Erzählen hingegen können Sie wählen, um bewusst größere Distanz herzustellen.
Je näher Sie die Leser an den Charakter heranholen, desto störender wirken Erklärungen oder allgemein Informationen, die dem Charakter bekannt sind, die Sie also in erster Linie für die Leser schreiben und die damit außerhalb der Story liegen.
Das können offensichtliche Dinge sein, etwa hier:
Karin, meine dreiundsiebzigjährige Mutter, hatte nicht geahnt, dass wir sie an diesem Tag noch sehen würden.
Die Protagonistin, in dessen Perspektive die Leser hier stecken, weiß natürlich, wer Karin ist, und kennt selbstverständlich auch ihr Alter.
Weniger offensichtlich hier in diesem Ausschnitt:
»…
Marieka seufzt leise, sie scheint nicht sehr überzeugt, aber von meinem Platz aus kann ich ihr Gesicht nicht sehen. Was ist mit Mila?, sagt sie.
Ein paar Dinge weiß ich: Es sind Osterferien, ich muss nicht in die Schule. Meine Mutter arbeitet die ganze Woche in Holland, und allein kann ich nicht zu Hause bleiben. Mein Vater lebt in seiner eigenen Welt, darum ist es besser für ihn, wenn er beim Reisen jemanden bei sich hat, der auf ihn aufpasst. Die Flugtickets wurden schon vor zwei Monaten gekauft.
Wir werden also beide fahren.
…«
(Meg Rosoff, »Was weiß ich von dir«, Fischer KJB 2014)
Alles, was der Ich-Erzähler hier unter »Ein paar Dinge weiß ich« fasst, sind streng genommen Erklärungen für die Leser. Der Ich-Erzähler weiß das ja alles, würde also bei einem sehr nahen POV nicht auf diese Weise und mit diesen Worten daran denken.
Schon der unverdächtige Satz »von meinem Platz aus kann ich ihr Gesicht nicht sehen« ist eine Erklärung (samt der Instanz des Sehens), die den Lesern gegeben wird, gegeben werden muss, weil die Leser dem Ich-Erzähler eben nicht sehr nahe sind.
Dichter dran wäre etwa diese abgewandelte Fassung:
Marieka seufzt leise, sie scheint nicht sehr überzeugt, aber hinter Gil ist ihr Gesicht nicht zu sehen.
Hier spielt noch ein Faktor hinein: das Tempus. Wählt ein Autor eine Ich-Erzählerin und lässt sie im Präsens erzählen, will er damit bei den Lesern ja den Eindruck erwecken, die Ich-Erzählerin würde gerade in der Situation stecken. Und zwar just in dem Moment, in dem die Leser den Roman lesen. Eine solche Erzählerin aber würde eben nicht erzählen, sondern erleben – und die Leser miterleben lassen.
Das Erzählen (als Gegenpol zum Zeigen) passt, von der Erzählzeit her, besser zum Präteritum. Denn hier sagt schon das Tempus, dass die Ereignisse vergangen sind.
Merke
Zeigen heißt, die Leser miterleben zu lassen.
Auch die anderen Erklärungen aus Meg Rosoffs Romanauszug können wir näher heranholen. Etwa so:
Besser, jemand passt auf Papa auf, damit er in seiner eigenen Welt nicht verlorengeht, gerade auf Reisen ist das sicherer.
Das Erzählen – genauer: der Erzähler – ist, ebenso wie das Tempus und Verben der Wahrnehmung und Empfindung, eine Instanz[Fußnote 26] , die Sie zwischen Leser und Charakter oder zwischen Leser und Story schalten.
Faustregel
Jede Instanz vergrößert die Distanz.
Indem Sie die Zahl der Instanzen zwischen Leser und Romanfigur verringern, rücken Sie die Leser dichter an Ihren Protagonisten heran.
Während bei einer nahen Erzählweise Gedanken und Erzählen eins werden, bedeutet die Kennzeichnung von Gedanken als solche eine weitere Instanz.
»…
Elisabeth saß auf dem Rand ihres Bettes. Um des lieben Friedens willen hatte sie noch die Schwarzwurzeln geputzt. Sie schaute auf ihre Hände, die klebrig waren und voller Flecken. Mein Leben steht still, dachte sie. Seit diesem Tag. Sie konnte sich mühelos an den Geruch des Büros erinnern: Bohnerwachs und gestärkte Röcke.
…«
(Kris van Steenberge, »Verlangen«, Klett-Cotta 2016)
Protagonistin Elisabeths Gedanken werden klar als Gedanken gekennzeichnet. Doch wer erzählt dieses »dachte sie«? Ein Erzähler, der nicht mit Elisabeth identisch ist, und damit eine zwischengeschaltete Instanz, die für Distanz sorgt.
Gedanken wirken beim distanzierteren Erzählen eher wie etwas lautlos Gesagtes, wie ein stiller Dialog der Figur mit sich selbst – den der Erzähler mitschreibt.
Anders gesagt: Beim nahen Erzählen erlebt der Charakter die Gedanken, beim distanzierten Erzählen werden die Gedanken vom Erzähler bloß zitiert .
Lesen wir den Abschnitt noch einmal, dieses Mal aus einer näheren Erzählperspektive geschildert:
Elisabeth saß auf dem Rand ihres Bettes. Um des lieben Friedens willen hatte sie noch die Schwarzwurzeln geputzt. Sie schaute auf ihre Hände, die klebrig waren und voller Flecken. Mein Leben steht still. Seit diesem Tag. Sie konnte sich mühelos an den Geruch des Büros erinnern: Bohnerwachs und gestärkte Röcke.
Da die Leser die ganze Zeit schon bei dieser Romanfigur sind, wissen sie, dass der Gedanke »Mein Leben steht still« von Elisabeth kommt und nicht von einem Erzähler. Was aber ist das »dachte sie« anders als Erzählen? Eben.
Achten Sie auf das Tempus der Gedanken. Sie werden hier im Präsens wiedergegeben, was die Leser ebenfalls näher an den Charakter heranholt (siehe oben).
Eine weitere Instanz lässt die Autorin bereits weg: die optische Kennzeichnung des Gedankensals solchen. Sie hätte die Gedanken kursiv oder gar in Anführungszeichen setzen können und hätte Elisabeth damit ein weiteres Stück vom Leser entfernt. Jede Abweichung im Schriftbild, allgemein im Layout, zieht die Aufmerksamkeit auf sich, umgekehrt erleichtert ein gleichmäßiger visueller Eindruck des Textes das Versinken der Leser in der Geschichte.
Das sehen wir uns genauer an:
»…
Als er seinen Namen nannte, Rudolf Born, musste ich sofort an den Dichter denken. Irgendeine Verwandtschaft mit Bertran?, fragte ich.
Ah, erwiderte er, der arme Kerl, der seinen Kopf verloren hat. Möglich, aber wohl leider nicht wahrscheinlich. Mir fehlt das de. Dazu muss man von Adel sein, und die traurige Wahrheit ist, dass ich alles andere als ein Adliger bin.
…«
(Paul Auster, »Unsichtbar«, Rowohlt 2010)
Falls die Leser tief im Charakter stecken, wird die optische Kennzeichnung überflüssig: Sie wissen genau, was der Charakter laut ausspricht, was er denkt oder was er nur erzählt.
Читать дальше