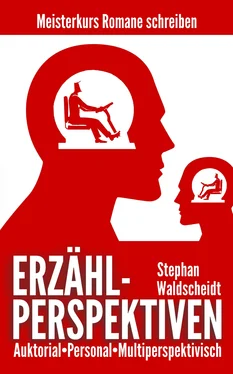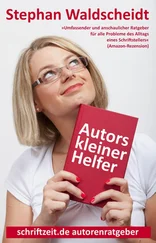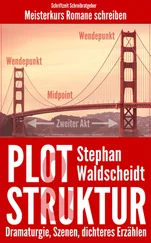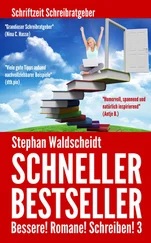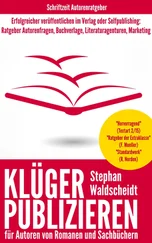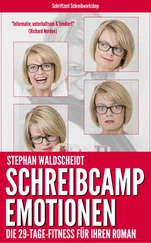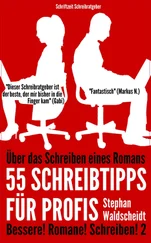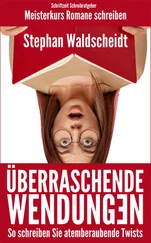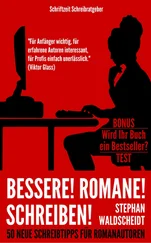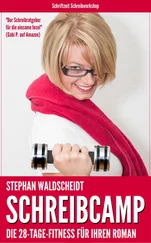1 ...6 7 8 10 11 12 ...22 Schreibtipp
Das Innenleben können Sie durchaus mal unterschlagen – an einer Stelle und pointiert –, um eine Überraschung oder einen Twist vorzubereiten.
Nahe zu erzählen, heißt auch: durch den Filter des Erzählers oder POV-Charakters. Je stärker das (objektiv) Wahrnehmbare vom (subjektiven) Filter verändert wird, desto intimer, authentischer und näher wirkt die Erzählweise.
Letztlich stellen sich Ihnen die zentralen Fragen, die uns bei jeder Perspektivwahl begegnen werden: Was wollen Sie bei den Lesern erreichen? Und was wollen Ihre Leser von Ihrem Roman?
Denken Sie etwa an Frank Schätzings Buchbacksteine wie »Der Schwarm« oder »Limit«. Darin gelingt es ihm gut, die Leser nahe an die Ereignisse und an das Thema heranzuholen. An die Charaktere holt er sie eher weniger heran. Die in diesen Romanen erzeugte Nähe ist eine eher intellektuelle, kopfgesteuerte Nähe, mehr Verständnis als Mitgefühl, und genau das, was Leser in dieser Art Roman suchen.
Emotional am nächsten aber kommen die Leser Ihrem Roman als Ganzes dann, wenn sie mit den Charakteren mitfiebern und sich mit ihnen identifizieren. Idealerweise sorgt diese Nähe zu den Figuren für die Nähe zu Handlung und Thema. Logisch: Wir interessieren uns mehr für Ereignisse und Themen, wenn uns die Menschen nahe sind, denen diese Ereignisse widerfahren oder denen die Themen etwas bedeuten. Daher betrachten wir im Folgenden vor allem die emotionale Nähe oder Distanz zwischen Leser und Figur. Dass Sie alternativ oder zusätzlich Nähe zur Handlung, zum Thema, zum Setting herstellen können, behalten Sie im Hinterkopf.
Vergleichen Sie die Anfänge von zwei der größten Klassiker der Weltliteratur:
»…
Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise.
Drunter und drüber ging es bei den Oblonskis. Die Frau des Hauses hatte erfahren, dass ihr Mann eine Liaison hatte mit einer Französin, die als Gouvernante im Haus gewesen war, und hatte ihrem Mann verkündet, dass sie nicht mehr im selben Haus mit ihm leben könne. Diese Situation dauerte schon den dritten Tag und wurde sowohl von den Eheleuten wie von allen Familienmitgliedern und Hausgenossen als qualvoll empfunden. Alle Familienmitglieder und Hausgenossen hatten das Gefühl, dass ihr Zusammenleben keinen Sinn habe und dass in jedem Absteigequartier die zusammengewürfelten Gäste mehr miteinander verbinde als sie, die Familienmitglieder und Hausgenossen der Oblonskis. Die Frau des Hauses kam nicht aus ihren Räumen, ihr Mann war den dritten Tag nie daheim.
Die Kinder rannten wie verloren im Haus herum; die Engländerin hatte sich mit der Wirtschafterin zerstritten und schrieb einer Freundin ein Billett, sie möge sich nach einer neuen Stelle für sie umtun; der Koch hatte gestern das Weite gesucht, noch während des Diners; Küchenmagd und Kutscher baten um Auszahlung.
…«
(Leo Tolstoi, »Anna Karenina«, Hanser in der Übersetzung von 2009, Original von 1877)
»…
»Was ist das. – Was – ist das …«
»Je, den Düwel ook, c’est la question, ma très chère demoiselle!« Die Konsulin Buddenbrook, neben ihrer Schwiegermutter auf dem geradlinigen, weiß lackierten und mit einem goldenen Löwenkopf verzierten Sofa, dessen Polster hellgelb überzogen waren, warf einen Blick auf ihren Gatten, der in einem Armsessel bei ihr saß, und kam ihrer kleinen Tochter zu Hilfe, die der Großvater am Fenster auf den Knieen hielt.
»Tony!«, sagte sie, »ich glaube, daß mich Gott –« Und die kleine Antonie, achtjährig und zartgebaut, in einem Kleidchen aus ganz leichter changierender Seide, den hübschen Blondkopf ein wenig vom Gesichte des Großvaters abgewandt, blickte aus ihren graublauen Augen angestrengt nachdenkend und ohne etwas zu sehen ins Zimmer hinein, wiederholte noch einmal: »Was ist das«, sprach darauf langsam: »Ich glaube, daß mich Gott«, fügte, während ihr Gesicht sich aufklärte, rasch hinzu: »– geschaffen hat samt allen Kreaturen«, war plötzlich auf glatte Bahn geraten und schnurrte nun, glückstrahlend und unaufhaltsam, den ganzen Artikel daher, getreu nach dem Katechismus, wie er soeben, anno 1835, unter Genehmigung eines hohen und wohlweisen Senates, neu revidiert herausgegeben war. Wenn man im Gange war, dachte sie, war es ein Gefühl, wie wenn man im Winter auf dem kleinen Handschlitten mit den Brüdern den »Jerusalemsberg« hinunterfuhr: es vergingen einem geradezu die Gedanken dabei, und man konnte nicht einhalten, wenn man auch wollte.
…«
(Thomas Mann, »Buddenbrooks«, S. Fischer 2014 (Erstausgabe 1901))
Beide Anfänge werden auktorial erzählt, beide beginnen mit der Schilderung eines Familienlebens. Während Tolstoi eher einen Überblick über die Verhältnisse gibt, schreibt Mann szenisch, bringt Dialog und dringt in die Gedanken seiner Charaktere vor. Sein Erzähler ist den Charakteren näher, Tolstois Erzähler bleibt mehr auf Distanz.
Übersetzungen
Tolstois Text oben ist eine Übersetzung. Da Übersetzungen nur Annäherungen sein können, nehmen Leser zu ihnen und ihren Charakteren häufig eine andere Distanz ein als zum Original. Schwerwiegender: Die Distanz des Originals über die Länge des Romans auch beizubehalten, stellt höchste Anforderungen an den Übersetzer. Bei manchen Werken ist das kaum möglich.
Je nach Schwierigkeit der Übertragung, dem Sachverstand des Übersetzers und der Zeit, die der Verlag ihm für seine Arbeit zur Verfügung stellt, können Abweichungen in der Distanz wenig ausmachen. Aber auch sehr viel. So mag eine in der Übersetzung nicht erreichte Nähe ein Grund dafür sein, dass die Übersetzung hinter dem Erfolg des Originals zurückbleibt.
Hinzu kommt, dass Leser automatisch mehr Nähe entwickeln zu vertrauten Umgebungen, Situationen oder Sprechweisen. So hat ein Deutscher, der Stephen King auf Deutsch liest, sowohl mit der distanzierenden Übersetzung zu kämpfen als auch mit den von Deutschland sehr verschiedenen sozialen Gefügen und Regeln, den Situationen und Interaktionen der Menschen in den USA.
Vielleicht denken Sie künftig daran, wenn Sie, als Leserin oder Leser, ein übersetztes Buch aus einer anderen Kultur bewerten. Ihnen als deutschsprachigem Autor oder deutschsprachiger Autorin bringt das einen Heimvorteil bei Agenten, Verlagen, Buchhändlern und Lesern in Deutschland, Österreich oder der Schweiz – den Sie nutzen sollten, indem Sie sich besondere Mühe bei der Justierung von Nähe und Distanz in Ihrem Roman geben.
Leser kommen Ihren Charakteren umso näher, je tiefer Sie sie in das Innenleben dieser Figur eintauchen lassen und je unmittelbarer ihnen die Gedanken oder Gefühle präsentiert werden.
In der Tiefe gibt es Abstufungen: von einer oberflächlichen Zusammenfassung bis zur extremen Tiefe eines Bewusstseinsstroms.
• zusammengefasst erzählte Gedanken
In ihrem Kopf fügten sich die Einzelheiten endlich zu einem Ganzen.
• detailliert erzählte Gedanken
Sie mochte Clara nicht, nicht mehr, und sie würde ihr morgen Abend nicht gratulieren.
• erzählte und gezeigte (direkte) Gedanken, optisch abgesetzt
Clara kann mich mal , dachte sie. Von mir kriegt sie nur die kalte Schulter.
• gezeigte Gedanken, optisch abgesetzt
Clara kann mich mal. Von mir kriegt sie nur die kalte Schulter.
• gezeigte Gedanken
Clara kann mich mal. Von mir kriegt sie nur die kalte Schulter.
• Bewusstseinsstrom
Clara, vergiss es, diese … diese, ach, diese Verräterin hatte alles verdient, nur kein Geschenk, hoffentlich hat sie den Schal von letztem Jahr weggeschmissen, den ich ihr … ich hätte es wissen können, nein, wissen müssen, ich hätte …
Читать дальше