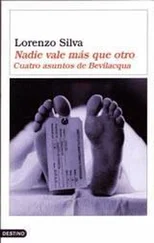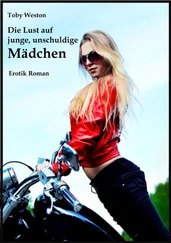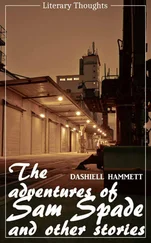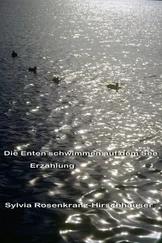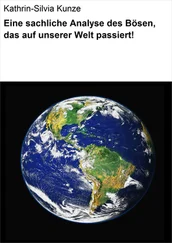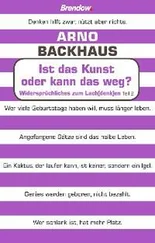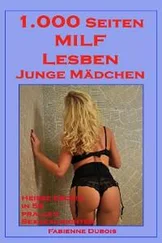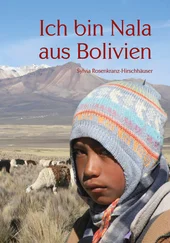Bewusstmachen und Abbau geschlechtsspezifischen Rollenverhaltens als eine Intention des Deutschunterrichts
Die Examensarbeit aus dem Jahr 1975 zeigt in vielfältiger Hinsicht die damalige aktuelle Auseinandersetzung mit der Geschlechterrolle ebenso wie den damals zugrunde liegenden gesellschaftstheoretischen Hintergrund und einige konkrete Schul- bzw. Familienstrukturen.
In einer mehrere Unterrichtseinheiten umfassenden Folge versuchte ich elf- bis zwölfjährigen Schülerinnen und Schülern geschlechtsspezifisches Rollenverhalten zu verdeutlichen, ihnen bewusst zu machen, wie beeinflusst sie in ihrem Verhalten als Jungen oder Mädchen sind.
Während des Durcharbeitens der Arbeit von 1975 zu diesem Buch, wurde mir selbst einerseits sehr plausibel, wie berechtigt der Ansatz zu Aufklärung war und wie rigide andererseits gesellschaftlich damals ‚umgedacht’ werden sollte. Jungen sollten sich so verhalten wie Mädchen und Mädchen wie Jungen, sie sollten sich gegenseitig in die ‚Rolle’ des jeweils anderen entwickeln.
Entwicklungspsychologisch betrachtet sind Kinder dieser Altersstufen prägsamer in Verhaltensänderungen und aufgeschlossener in Lernprozessen, so dass ein kritischer Blick auf konservative Rollennormen durchaus Erkenntnisse bringen kann, die verändertes Rollenverhalten zur Folge haben können.
Vergessen hatte ich inzwischen, wie traditionell die Rollenbilder in den Siebzigerjahren in den Köpfen der Mitglieder unserer Gesellschaft verhaftet waren und wie sie in den Familien gelebt wurden. Aussagen der Schüler/innen bezeugten dies überdeutlich.
Detailliert können im Anhang des Buches aussagekräftige Passagen meiner Examensarbeit nachgelesen werden.
An dieser Stelle möchte ich einige Sätze ‚aus Kindermund’ der Fünftklässler zitieren, die für sich sprechen.
Antworten von Mädchen auf die Frage: ‚Warum ich kein Junge sein möchte‘
- Ich möchte lieber ein Mädchen sein, weil es so schöne Dinge gibt, die Jungen nicht haben können. Und weil ich später Kinder haben möchte. Außerdem können Mädchen auch handarbeiten und Jungen können nicht handarbeiten. Mädchen können später auch kochen und die Jungen nicht. (Martina)
-Jungen bekommen mehr Schläge. Jungen sind böse in der Schule und darum sprechen andere Menschen über sie. Das habe ich nicht gern. Meine Mutter ist froh, wenn ich ihr helfe. Meine Mutter hat viel Arbeit und ein Junge hilft ihr nicht. Jungen sind meistens zu dem Lehrer frech und dann bekommen sie einen blauen Brief nach Hause, darum möchte ich kein Junge sein. (Sabine)
-Ein Junge ist nicht wie ein Mädchen. Der Junge spielt mehr Indianer und andere Wildwestspiele. Die Jungen ärgern die Mädchen und fühlen sich stark dabei. Aber wenn die Mädchen dann ihre Kraft zeigen wollen, lachen die Jungen nur. (Doris)
-Ich möchte gerne ein Mädchen sein, weil ich später mal Kinder haben möchte. Mädchen sind auch viel fleißiger als Jungen. Mädchen können auch Röcke tragen und Jungen nicht. Mädchen können auch kleine Kinder ausfahren und Jungen nicht. Jungen müssen zur Bundeswehr und Mädchen nicht. (Silke)
-Weil ich später Kindermöchte. Wenn ich ein Mädchen bin, kann ich Schmuck tragen. Ich finde, Mädchen haben schönere Kleidung. Später möchte ich auch als Mädchen kochen im Haushalt. An einem Teil möchte ich nicht so gerne Mädchen sein, weil man die Periode bekommt. (Astrid)
-Weil ich später Kinder bekommen will und den Haushalt führen will. Meine Mutter hat sich sehr über mich gefreut, dass ich ein Mädchen geworden bin, weil sie schon drei Jungen hat. Und ich bin heute noch froh darüber. (Anja)
Antworten von Jungen auf die Frage: ‚Warum ich kein Mädchen sein möchte‘
-Weil ich nicht so gerne abwaschen und abtrocknen will. Ich spiele auch nicht gerne mit Puppen und ich kehre auch nicht gerne die Küche. (Harald)
-Ich will kein Mädchen sein, weil die so zimperlich sind und sie gehen immer so vornehm über die Straße. Und dann müsste ich auch aufwaschen und ich müsste immer wieder einkaufen, die Arbeit mache ich nicht gerne und dann könnte ich auch nicht ins Schwimmbad. Da hätte ich nicht so viel frei wie ein Junge es braucht. Dann darf ich nicht mit meinen Freunden spielen und darf mich nicht schmutzig machen und wenn ich mich schmutzig mache, bekomme ich geschimpft. Dann darf ich nicht mit Autos spielen und ich spiele auch nicht mit Puppen, weil das macht mir keinen Spaß und ich müsste kochen helfen, das macht mit auch keinen Spaß, das hängt mir dann zum Hals heraus. Und ich darf nicht auf die Bäume klettern, wenn ich mir den Rock zerreiße, bekomme ich Schläge. Und ich will keine Röcke tragen, weil das nichts aussieht. (Ulrich)
-Weil ich nicht im Haushalt helfen will und ich will auch keine Kinder bekommen und ich will auch keine Röcke anziehen. (Andreas)
-Die Mädchen sind so zimperlich. Die Mädchen müssen aufwaschen und abtrocknen, das möchte ich nicht. Aber die Jungen sind stärker als die Mädchen, weil sie Holz und sonstige Dinge holen können, da sind die Mädchen zu fein für. (Jürgen)
Wie viel sich in den mehr als dreißig Jahren, einer Generation verändert, entwickelt hat, wurde und wird mir während des Schreibens bewusst, indem ich die verschiedenen Situationen und Erlebnisse schildere.
Während der Erziehungszeit meiner beiden Töchter erlebte ich vielfältige Situationen, in denen ich zu ‚geschlechtsspezifischem Verhalten’ meine eigenen Erfahrungen sammeln konnte und oft gegen meine bis dahin überzeugt vertretene Meinung, man könne entscheidend Einfluss auf typisches Jungen- und/oder Mädchenverhalten nehmen, vieles sei eben Erziehung und kulturell bedingt, sehr häufig eines besseren belehrt wurde.
Es reihten sich im Laufe der Jahre Beispiele an Beispiele, von denen ich die erzählen möchte, die mir am intensivsten in Erinnerung blieben.
Es war für mich selbstverständlich, dass ich meine Töchter so erzog, dass ihnen alle Möglichkeiten der persönlichen individuellen Entfaltung offen stünden, dass sie sich ihren Begabungen, Fähigkeiten und Interessen entsprechend entwickeln konnten. Dazu gehörte ein breitgefächertes Angebot an Handlungsmöglichkeiten, an Lern- und Spielsituationen, später eine optimale Schulbildung und die Möglichkeit, Musik- und Sportangebote wahrnehmen zu können.
Im Kleinkindalter bot ich meinen Töchtern eine umfangreiche Palette an Spielzeug an, natürlich nicht mädchentypisch, sondern vielfältig: Bagger, Autos, Kräne, alles gehörte zu ihrem Spielrepertoire. Es sammelte sich eine Menge Autos an bis meine älteste Tochter Julia ungefähr im Alter von der Jahren sagte: Mama, wie lange willst du mir eigentlich noch Autos schenken? Du weißt doch, dass ich mich dafür nicht interessiere. Eine klare Aussage, an die ich mich hielt.
Julia liebte Rollenspiele, malte gerne und war im Spiel sehr kreativ. Technische Spielsachen brauchte sie dazu nicht. Ihr Schwerpunkt lag im Gestalten.
Der Vater meiner Kinder war ein handwerklich begabter Mann, der viel selbst reparierte, baute und eine Werkstatt im Haus besaß.
Die Kinder konnten also (im Gegensatz zu mir als Kind: mein Vater hatte zwei extrem linke Hände) durchaus praktische, handwerkliche Tätigkeiten sehen und sich dem Tun anschließen. Meine jüngere Tochter Lena nutzte dies auffallend häufiger als Julia.
In der Krabbelgruppe waren die Jungen aktiver, mobiler, auch aggressiver, sie wechselten häufiger ihre Position und ihr Spielzeug. Die Mädchen verhielten sich überwiegend stoischer, beschäftigten sich länger mit einer Sache, bewegten sich weniger hektisch.
Lena war lebendiger in ihrer Bewegung als Julia, Julia war besonders ruhig und besonnen. Lena bewegungsfreudiger.
Im Kindergarten gab es die berühmte Bauecke (Jungen) und die Puppenecke (Mädchen). Julia und Lena spielten in beiden Ecken, überwiegend in der Puppenecke, da dort mehr Mädchen zusammen waren.
Читать дальше