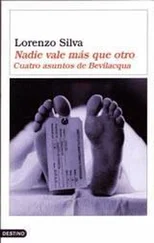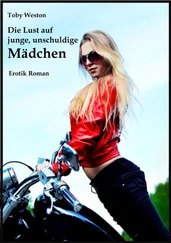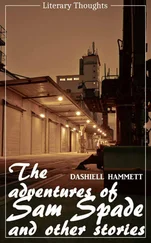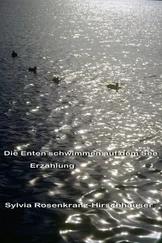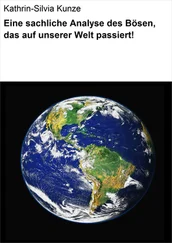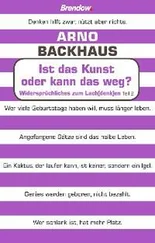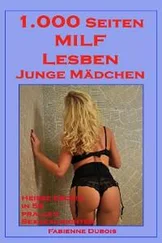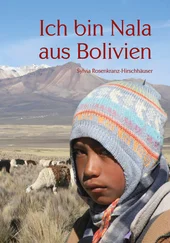Seit meiner Ehe führte ich einen Doppelnamen (war zu Zeiten meiner ersten Ehe noch der Name des Mannes an erster Stelle: ich hieß ‚Eckhardt-Rosenkranz’, so bestand zu Zeiten meiner zweiten Ehe die Regelung, den ‚Mädchennamen’ (auch so ein Begriff!) voranzustellen, entsprechend heiße ich ‚Rosenkranz-Hirschhäuser’).
Für mich stand nie außer Frage, meinen Namen bei zu behalten. Unsere Ehe wurde 1979 geschlossen und ich erinnere mich an heiße Diskussionen hinsichtlich der Namensänderung. Da es möglich war, als Mann auch den Namen der Frau anzunehmen oder sich als Mann auch einen Doppelnamen zuzulegen, mussten Entscheidungen dazu getroffen werden. Ich kenne aus der Zeit der Siebziger Jahre keinen Mann, der den Namen seiner Frau angenommen hätte, ich kenne wenige, die einen Doppelnamen trugen. Mein damaliger Ehemann machte eine Lachnummer aus der Vorstellung, er nähme meinen Namen an (stellt euch vor, ich komme morgens in die Bank und sage: ich heiße jetzt ‚Rosenkranz’ und nicht mehr ‚Hirschhäuser’ – hahahaha), es war für ihn unvorstellbar, da er darin ein Gefühl des Lächerlichwerdens empfand. Der Glaube, seine Kollegen würden sich über ihn lustig machen, stand hinter dem Gefühl.
Ich gebe gerne zu, dass ich (noch heute) bei Frauen ihre ‚feministische Gesinnung’, ihr Selbstbewusstsein Männern gegenüber, ihre gesellschaftliche Rolle als Frau auch –natürlich nicht nur- durch die Namensentscheidung interpretiert sehe: eine Frau mit Doppelnamen ist für mich ‚stärker’ emanzipiert als eine Frau, die den Namen ihres Mannes angenommen hat. Andererseits – ich kann mich dieser Einschätzung nicht entziehen- sehe ich auch eine ‚Schwäche’ im Mann, wenn er den Namen der Frau annimmt. Dies wiederum zeigt mein persönliches Rollenmuster.
Heute ist die Klärung der Namensfrage einfacher geworden und ein weit weniger wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Die Namen eines jeden können beibehalten werden und das ist gut so. (Einschränkung in meiner subjektiven Meinung: sind Kinder da, finde ich es besser, wenn ein gemeinsamer Familienname zu erkennen ist, der den Kindern die Beziehung zu den Eltern aufweist). Dass die Namensfindung gegenwärtig ein gesellschaftlich kaum relevantes Thema zwischen Männern und Frauen ist, eine Oberflächlichkeit bedeutet, zeigen die vielen unverheirateten Paare und Eltern. Insofern steht dieser kleine Exkurs nur am Rande.
Warum ich die Namensfindung erwähne? Sie kennzeichnet das Männer-Frauen-Denken in der jeweiligen Zeit und die gesellschaftliche Stellung der Frau (bekannt sind die Zeiten, in denen sich die Frauen mit dem Doktortitel ihres Mannes ansprachen ließen). Ein klein wenig zeigt die Namensentscheidung auch das emanzipatorische Bewusstsein der Frau (dagegen höre ich oft den Satz: ich mache mein Bewusstsein als Frau doch nicht an dem Namen fest!).
Es ließe sich hier eine Diskussion anschließen (wie in vielen anderen in diesem Buch aufgegriffenen gesellschaftlichen Mann/Frau-Bereichen), die den Umfang der Thematik sprengen würde. Letztendlich wäre es dann so, dass viele Meinungen und Beurteilungen nebeneinander stünden und jede/jeder seine individuelle Biographie mit einbrächte.
Eine weitere persönliche Entscheidung, die im Zusammenhang mit meiner ‚gelebten’ Frauenrolle steht– wie ich mich, subjektiv empfunden, gegenüber Männern zu behaupten vermag -, war die, einem von meinem damaligen Ehemann gewünschten Ehevertrag zuzustimmen. Der Ehevertrag beinhaltete im Wesentlichen, dass bei einer Trennung auf gegenseitigen Unterhalt verzichtet wird. Meine Situation als Frau bzw. Mutter im Voraus nicht kennend und einschätzend, stimmte ich dem Vertrag zu, da ich es als gerecht empfand, wenn jeder für sich selbst aufkommt. Im Nachhinein betrachte ich meine damalige Vorstellung als naiv und wenig durchdacht. Ich kannte die Familiensituation nicht und die Aufgabe als Mutter, für minderjährige Kinder zu sorgen, war mit in ihren Ausmaßen nicht bewusst.
Ich erwähne diese Situation, da sich darin der Widerspruch deutlich macht zwischen meinem sozialisierten Gleichberechtigungsempfinden, gleichberechtigte, finanziell von einander unabhängige Partner in einer Ehe zu sein- und dem, was sich später bei meiner Scheidung daraus entwickelte: eine finanzielle Abhängigkeit und einen materiellen Verzicht meinerseits auf gemeinsamen Besitz, den es aufzuteilen galt.
Ich empfand nur noch Ungerechtigkeit und machte mir Vorwürfe, mich auf den Vorschlag eines Ehevertrages eingelassen zu haben.
Ich hatte zwei Kinder groß gezogen, sie ohne fremde Hilfe (keine Großmutter, keine Tagesmutter, keine Kita) betreut und einige Jahre bewusst auf Berufstätigkeit verzichtet. Drei Jahre vor meiner Scheidung arbeitete ich wieder als Lehrerin mit halber Stelle. Nach der Scheidung trat der Ehevertrag in Kraft, durch den ich keinerlei Unterhalt erhielt, obwohl mein geschiedener Mann in sehr guter Position tätig war und ich mit meinen beiden Kindern in unserem gemeinsamen Haus und für Kinder, Haus und Garten zuständig war.
Mein geschiedener Ehemann zahlte für die Kinder Unterhalt, für mich keinen Cent.
Vielmehr ließ er sich den hälftigen Wert unseres Hauses sehr gut auszahlen.
Mein Gerechtigkeitsdenken wurde in dieser Zeit stark erschüttert, ich fühlte mich zum ersten Mal ‚Männern unterlegen’ und als Frau ungerecht behandelt. Ich erkannte das typische Mittelschichtsrollenbild: Mann verdient gut, kann sich weiter einen hohen Lebensstandard leisten, Frau ist als Mutter und berufstätig in der Doppelbelastung und finanziell schlechter gestellt als der Exmann, in meiner eigenen Geschichte.
Ohne die finanzielle Unterstützung meiner Mutter hätte ich meinen Kindern und mir das gemeinsame Haus nicht erhalten können.
Die Trennung ging damals von mir aus, ich hatte sie gewollt und da ich meinen Exmann sehr unter der Trennung leiden sah, war dies der Grund, warum ich meine finanzielle Unterlegenheit akzeptierte und damit leben konnte: ich hatte ein schlechtes Gewissen, ihm Kinder und Heim genommen zu haben. Die Gründe dafür stellte ich in den Hintergrund. Heute kann ich meinen Trennungsprozess nachvollziehen und meine Entscheidung als richtig werten: ich fühlte mich eingeengt, unterdrückt, nicht wahr genommen und fast immer falsch verstanden.
Die spürbare Trauer um den Verlust der intakten Familie, unter der mein geschiedener Mann lange Zeit litt, gab mir das Gefühl, wieder die Stärkere zu sein.
Ich stand nun in Unabhängigkeit ‚meine Frau’, fühlte mich autark und frei, wenn auch permanent an der Grenze zur Überforderung.
Im Zusammenhang mit der Erwähnung meines Ehevertrages unternahm ich einen Zeitsprung von fünfzehn Jahren und habe meiner Geschichte vorgegriffen.
Diese fünfzehn Jahre springe ich nun zurück und bleibe im Zeitraum der Geburt meiner Kinder.
Mutterwerden ist ein Privileg der Frauen. Etwas, was wir allen Männern voraushaben.
Als meine beiden Töchter zur Welt kamen, fühlte ich mich ihnen so nahe wie sonst niemanden, sie waren Teil von mir. Ein Ausdruck, der die Verbundenheit impliziert.
Heute bin ich sehr froh, Töchter zu haben. Ich bin der Überzeugung, ihnen mehr vermitteln zu können als Jungen, weil ich ihnen näher bin durch meine Gleichgeschlechtlichkeit, die besseres Verstehen ermöglicht. Ein Gefühl der Solidarität, weil wir Frauen sind. Ich spreche hier von mir und würde nicht verallgemeinern wollen, denn sicher gibt es andersartige Mutter-Tochter-Beziehungen.
Kinder bekommen zu können bildet eine Frauengemeinschaft, die in vielerlei Hinsicht verbindet, stärkt und Selbstwert schafft.
Ich hatte als Frau das Gefühl, mein Frausein nicht intensiver, stolzer und dankbarer erleben zu können, ein Überlegenheitsgefühl den Männern gegenüber sprach ich mir, wenn ich mich ehrlich analysierte, nicht ab.
Читать дальше