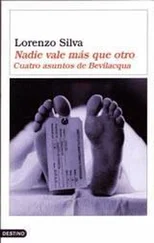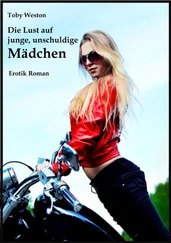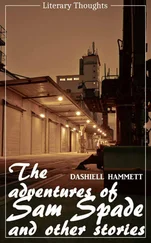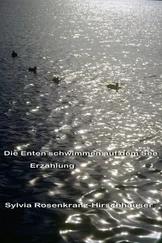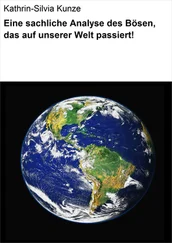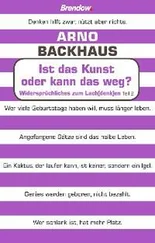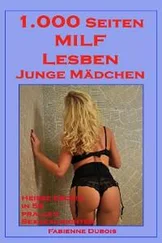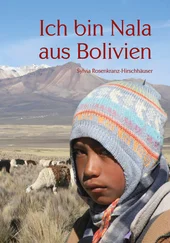Was wurde nun daraus?
Was dachte und tat ich und was denke und tue ich heute?
Exkurs in die Zeitgeschichte
Die fünfziger und sechziger Jahre
Ich wurde Ende 1949 geboren.
Männer hatten vor noch nicht allzu langer Zeit Krieg geführt und Frauen hatten mit heroischer Kraft die Trümmerarbeit in den Nachkriegsjahren geleistet.
Die neue Bundesrepublik konstituierte sich, Gleichberechtigung per Gesetz war festgeschrieben.
Die Wirtschaftswunderzeit schuf Arbeitsplätze und in den Familien herrschte Bürgerlichkeit. Die traditionelle Rollenverteilung von Mann und Frau war in den meisten Arbeiter- und Mittelschichts-Haushalten noch selbstverständlich, Ausnahmen bestätigten die Regel, während das bäuerliche Leben auf dem Lande den Gesetzen der Gleichberechtigung allein auf Grund des notwendigen Arbeitseinsatzes folgte, wenn auch mit dem Unterschied von ‚schwerer’ und ’leichter’ Arbeit (wobei die landwirtschaftliche Arbeit eigentlich keine ‚leichte’ Arbeit kennt).
Der Begriff der ‚Doppelverdiener’ etablierte sich in den Nachkriegszeiten in Ansätzen, es mussten erst die Voraussetzungen geschaffen werden: Frauen zogen allmählich in Bildung und Ausbildung Männern gleich, doch benötigte die Entwicklung dazu Jahre, eher Jahrzehnte.
In meiner Jugend waren Mädchen auf Gymnasien und an Universitäten noch stark unterrepräsentiert. Mädchen waren nicht in allen gesellschaftlichen Kreisen, aber doch nach überwiegender Meinung zum Heiraten und Haushaltführen bestimmt und wurde eine Frau berufstätig, war sie zu Doppelbelastung gezwungen oder alleinstehend ohne Familie, die Gleichberechtigung der Männer im Haushalt lag damals noch hinter dem gedanklichen Horizont.
Die Arbeitsbelastung in Haus und Garten beanspruchte weitaus mehr Zeit als heute, denn weder die (nicht unbedingt positive) Entwicklung der Fertigprodukte, der Küchengeräte sowie der Reinigungs- und Waschprodukte war so effektiv wie heute (dafür allerdings auch weniger anspruchsvoll und leistungsoptimiert).
Im politisch-gesellschaftlichen Leben schreiben sich viele teils geachtete, teils kritisch betrachtete und dennoch aufgrund ihrer politischen Leistung geschätzte Politiker in die Geschichtsbücher. Von Adenauer über Ehrhardt, Brandt, Wehner, Strauß und viele andere ‚wichtige’ Männer in der zweiten und dritten Reihe sind die Namen der ‚großen’ Frauen in der Politik der Fünfziger und Sechziger Jahre schnell genannt, sie waren rar: die ersten Ministerinnen wurden bezeichnenderweise für das Gesundheitsministerium und das Familienministerium ernannt: Elisabeth Schwarzhaupt 1961, gefolgt von Käthe Strobel, Anke Huber und erste Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit war Marie Schlei. Ältere werden sich an diese Namen erinnern, jüngere nicht, denn es fehlt ihnen der Bekanntheitsgrad der Männer dieser Zeit. Erst 1972 wurde Annemarie Renger erste Präsidentin des Deutschen Bundestages.
Als Jugendliche erlebte ich Politik als reine Männerdomäne und Frauen wie die genannten weckten meine Bewunderung.
In meinem unmittelbaren Umfeld waren Frauen als Mutter und Hausfrau beschäftigt, sie prägten entsprechend mein damaliges Gesellschaftsbild.
Wäre ich zur gleichen Zeit in der ehemaligen DDR aufgewachsen, hätte ich andere Erinnerungen. In den neuen Bundesländern war der Anteil weiblicher Arbeitskräfte, Kindergrippen- und Hortplätzen bekanntlich um ein Vielfaches höher.
Anhand meiner individuellen Biographie im exemplarischen Erleben seien in meinem Text gesellschaftliche Entwicklungen und Tendenzen ausgezeigt, die einerseits subjektiv zu werten sind, im Kontext aber eine objektive Gültigkeit erkennbar werden lassen.
Die Jahre der 68er, die antiautoritäre Bewegung, die Rebellion der Jugend – meiner Jugend – wirft Fragen auf, konfrontiert die Generation unserer Eltern mit Abbau von Konventionen, Kritik an bürgerlichen Normen und Werten, kurz die nächsten zehn Jahre sind Umbruch und Veränderung im Familiären wie im Politischen – im sozialkritischen Jargon der Linken nicht zu trennen – denn das eine bedingt das andere, zweifelsfrei. Es ist zunächst weniger die Geschlechterfrage, das gesellschaftliche Frau-Mann-Verhältnis, das für Turbulenzen sorgt, es ist mehr das Infragestellen der elterlichen Autoritäten und der kapitalistischen Wertvorstellungen, so wird auch mit dem Aufbrechen verkrusteter Hierarchien der Grundstein zu feministischer Politik in dieser Zeit gelegt.
Die siebziger Jahre
Die gesellschaftspolitische Situation der Siebziger Jahre ist bekannt:
Die Entwicklung der sechziger Jahre manifestiert sich, Politisierung der Jugend, Infragestellung herkömmlicher Werte, Abgrenzung zur Elterngeneration, Leben neuer Gesellschaftsformen (Kommunen, Wohngemeinschaften, ‚Leben ohne Trauschein’), die Blicke kapitalismuskritischer Menschen sind auf die Welt gerichtet und kriegführende Staaten werden öffentlich kritisiert.
Die Zahl studierender Frauen nimmt zu, die Zahl ausschließlicher ‚Hausfrauen’ ab.
Die Klage über Männer, die die von Frauen geforderte Arbeitsteilung nicht als selbstverständlich erachten und sich ihr weiterhin entziehen, bleibt konstant.
Dennoch wandeln sich die Formen des Zusammenlebens und der Gleichberechtigungsgedanke gegenüber Männern, die in Kinderbetreuung und Haushalt mehr Zeit und Engagement investieren sollen, gründet sich auf das stärkere Selbstbewusstsein der Frauen, die sich ihres Wertes zunehmend sicherer sind, vor allem in stetig wachsender Zahl.
Der Anspruch vonseiten der Frauen, sich anstehende Familien- und Haushaltsarbeiten zu teilen, ist höher geworden, ihre zunehmende Berufstätigkeit fordert den Einsatz der Männer in neuer Selbstverständlichkeit.
In den Wohngemeinschaften mischen sich die Geschlechterrollen gepaart mit politischem Bewusstsein zu unterschiedlichsten Konstellationen, oftmals weit weg von den traditionellen Mann- Frau-Bildern.
Äußerlich sind es die langen Haare der Männer, die ihre gesellschaftskritische antiautoritäre Haltung unterstreichen. Die Frauen tragen ihre lila Latzhosen als Symbol ihrer feministischen Bewegung.
Die siebziger Jahre sind die Ursprungszeiten der ‚Frauenpower’, eines Feminismus, der in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen ‚starke’, bedeutende Frauen Wegweiserinnen und Wortführerinnen für eine ganze Generation werden lässt:
Simone de Bouvoir, Alice Schwarzer, Angela Davis, Janis Joplin, Ina Deter und viele andere mehr.
In meiner persönlichen Biographie gaben mir die frauenbewegten Jahre nicht das Gefühl, nun werde endlich etwas zuvor Unerreichbares erreicht, sondern ich empfand die emanzipatorische Entwicklung im Grunde ‚normal’, so, wie die gesellschaftliche Rollenaufteilung eben sein sollte. Ich konnte auch nicht behaupten, für mich seien Rechte und Freiheiten erkämpft worden, ich betrachtete die errungene Gleichberechtigung als schon immer persönlich angestrebten Zustand. Schullaufbahn und Status gegenüber dem männlichen Geschlecht bedurften für mich selbst keiner Unterstützung von außen. So meinte ich.
In meiner Beziehung, die ab 1979 in eine Ehe führte, traten jedoch andere Verhältnisse zutage.
Zunächst hatte ich meinem inneren Gefühl nachgehend alle Freiheiten. In meinen Beziehungen nahm ich männliche Positionen ein: Affären und wechselnde Verhältnisse, wie sie zumindest in diesen Jahren eher Männern zugeschrieben wurden. Dass sich auch in diesem Bereich Frauen später emanzipierten ist eine andere Sache.
In die siebziger Jahre fiel mein bereits erwähnter Studienwechsel vom Studium der Veterinärmedizin zum Studium des Lehramtes für Grundschulen. Ich war berufsbezogen im typischen Frauenstudium angekommen. Und fühlte mich wohl.
Ich empfand den Beruf interessant, herausfordernd, kreativ und äußerst sinnvoll.
Читать дальше