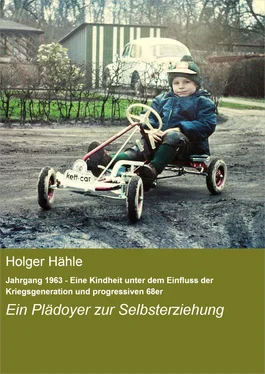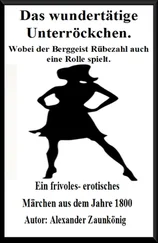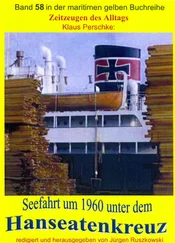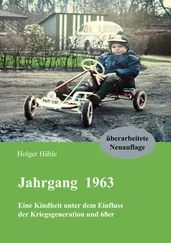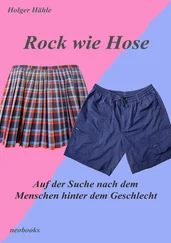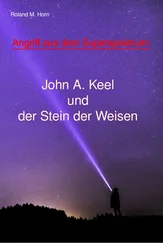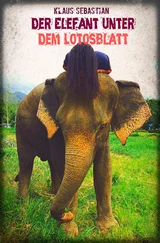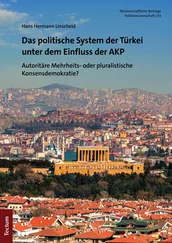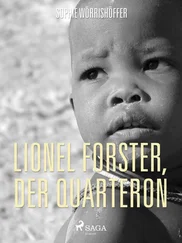Einer meiner Kumpels glaubte, dass das sogar schon für seine große Schwester galt, die schon Mofa fahren durfte und permanent genervt war und schon mal wegen seines Verhaltens ausrastete.
Stressresistenz war keine Eigenschaft, die Erwachsene auszeichnete. Die Erwachsenen waren sich bei ihren Entscheidungen trotzdem sehr sicher. Die Diagnose Hyperaktivitätsstörung für mein Verhalten, war oft schnell zur Hand. Der eigenen mangelnden Stressresistenz gaben die berufenen Gutachter kein Gewicht bei meiner Beurteilung.
Häufig kam das Urteil von Erziehern, die durch stilvolle Kleidung, Eitelkeit und gefühlte Wichtigkeit auffielen. Entfernt erinnerten sie an die Kinder, die beim Spielen immer die Bestimmer sein wollten. Sollte ihre in Mode gekommene Diagnose vor allem ihrem Ansehen dienen und sie kompetent wirken lassen? Wollten sie mit ihrer Diagnose auch ihr extrovertiertes Geltungsbedürfnis befriedigen, indem sie zeigten, dass sie über den pädagogischen Tellerrand hinaus blicken konnten und voll auf der Höhe der Zeit und der wissenschaftlichen Erkenntnis agierten? Es waren immer die gleichen Personen, die in ihrer gefühlten Wichtigkeit immer und zu allem sofort eine Meinung parat hatten. Zwei von ihnen wurden später tatsächlich auch zu Schulleitern.
Von den Anamnesen dieser Lehrer war ich jedenfalls sehr enttäuscht. Ich hatte es ihnen mehrmals sagen wollen. Jedes Mal wurde ich mit einem gnädigen Lächeln abgewürgt.
Zu meinem nachhaltigen Trost, gab es einen Erwachsenen, der meinen Standpunkt teilte. Das war mein Hausarzt. In meinem Alter war das natürlich ein Pädiater. Dr. Lindgen konnte den Klagen meiner Eltern, die diese mit Sorgenmine bereitwillig von den Erziehern und Lehrern übernommen hatten, sehr geduldig zu hören. Verständnis hatte er auch. Handlungsbedarf sah er nie.
Jedenfalls sollte die Einschulung später erfolgen, dann hieß es plötzlich am Ende der vierten Klasse, ich solle besser nicht ein Gymnasium besuchen. Letztlich tangierte mich ihre pädagogische Fachsimpelei nicht. Ich konnte mich sowieso nicht durchsetzen.
Meinen Weg würde ich trotzdem konsequent weitergehen. Ich würde weiter den Wald hinter unserem Haus erforschen und später ein Naturwissenschaftler werden. Das würden die Erwachsenen nicht verhindern können. Und so wird es kommen. Als ich viele Jahre später während meiner Promotion in meine Heimatstadt komme, um meine Eltern zu besuchen, war ich beim Gang über den Markt versucht, das einem alten Lehrer auf die Nase zu binden. Ich entscheide mich, es bleiben zu lassen. Irren ist menschlich. Das gilt auch für Erwachsene mit pädagogischer Fachbildung. Ein Problem bleibt es trotzdem, weil nun mal Kinder damals wie heute, Erwachsene als Vorbilder nehmen und sich gerne zum Volltrottel machen, wenn die Erwachsenen signalisieren, dass das ein zutreffendes Prädikat ist.
Gespräche verlaufen selten wie geplant
Schon meine Gedanken stürmten in einer Menge und Geschwindigkeit in mein Bewusstsein, dass ich nicht an ihnen halten konnte, denn so schnell zogen sie weiter, um neuen Eindrücken Platz zu machen. Das Problem bekam eine zusätzliche Dimension, wenn ich meine Gedanken mit anderen teilte. Vor allem verliefen Gespräche so schnell, viel zu schnell. Man konnte gar nicht schnell genug reagieren. Nie hatte ich das Gefühl alles zu gesagt zu haben, was ich wusste bzw. was relevant war. Zum Ende hin blieb so viel offen, dass noch gesagt werden müsste. Die Dynamik in Gesprächen führte zu unreflektierten Reaktionen. Häufig fühlte ich mich falsch verstanden. Ich fühlte mich immer wieder wie in einem Film, der einmal gestartet, abläuft bis zum Nachspann. Alles ist vorbestimmt. Eine Intervention ist unmöglich.
Nur in meinen Monologen dachte ich tatsächlich, was ich in Dialogen gerne gesagt hätte. Wieso wusste ich so viel mehr, als ich zu sagen wusste? Ich würde Fortschritte machen, aber es würde immer wieder Leute geben, die eloquenter sind. Immer wieder entschied nicht das Gewicht von Argumenten den Gesprächsausgang. Das lag auch an gekonnten Inszenierungen. Der Einsatz von Stilmitteln wie Lautstärke, Dreistigkeit, Penetranz und Empörung waren gesprächsbegleitende Emotionen mit einschüchternder Wirkung. Da gab ich schnell klein bei.
Meine einzige Waffe gegen Einschüchterung wurde es, mich immer wieder auf den Gesprächsgegenstand zu beziehen. Mit aller Kraft versuchte ich, mich emotionalen Anschlägen zu erwehren, auch indem ich versuchte, selbst möglichst emotionslos zu antworten. Ich versuchte auf der Ebene zu bleiben, die ich verstand.
Viele Jahre später würde ein Kommunikationstrainer bei einem Vortrag folgenden Satz sagen: „Ihr müsst das Gespräch immer wieder auf die Sachebene zurückführen“
Dieser Satz löste bei mir ein kleines Déjà vu aus. Genau das war damals auch meine Intention.
Da wo sich Gespräche anbahnten, bereitete ich mich zudem zukünftig auch noch vor. Ich machte mir Notizen und entwickelte Argumentationsstrategien. So handhabte ich das auch, als ich für Sabine schwärmte. Ich brachte einfach meinen romantischen Monolog zu Papier. Dann fasste ich alles auf einer kleinen Karte (A6) in kurzen prägnanten Wendungen zusammen. So konnte ich beim Vortrag jede Windung meiner Gedanken in Worte fassen. Als ich die Karte in der Art anwendete, wie ich das im Fernsehen bei Moderatoren in Interviews gesehen hatte, reagierte mein Schwarm enttäuscht.
„Wie unromantisch und unecht“, waren ihre enttäuschten Worte. Und eine Freundin ergänzte: „Wahre Gefühle sprudeln doch einfach aus dem Herzen direkt durch Augen und Mund heraus.“
Mein Geschenk, ein kleines Penatencreme ®-Pröbchen nahm sie trotzdem. Ich war resigniert. Verstehen konnte ich das nicht. Wie sollte ich etwas sprudeln lassen, wenn ich einen Kloß im Hals hatte. Das Problem lag doch genau darin, dass es mir technisch nicht gelang, die vorhandenen und registrierten wahren Gefühle rauszulassen. Eloquenz war mir nicht angeboren.
Trotz des ausbleibenden Erfolgs entwickelte ich meine Methode weiter. Einige fanden mich dann gefühlskalt. Aber ich empfand es als gefühlskalt, wenn man mich mit Emotionen erschlug, die ich nicht händeln konnte. Der Bezug auf die Sachebene, machte mich sicherer. Ich redete über das, was ich verstand. Die emotionale Auseinandersetzung brauchte noch viel Geduld und Übung. Noch heute ist mir die Befindlichkeit eines Gesprächspartners nicht immer klar. Menschen können sehr subtil sein.
Viele Erinnerungen sind mir nicht geblieben. Wahrscheinlich sind sie untergegangen in meinem ständigen Aktionismus. Allein an häufiges erinnere ich mich deutlich. Das war bei meinem Temperament auch nicht zu verhindern.
Ich kann mich noch an eine einzige Geschichte erinnern, die uns vorgelesen wurde. Es war die Fabel vom Bauern, der mit dem Wetter, so wie es Gott machte, nicht zufrieden war. Der Bauer glaubte, er könne das besser. Also gab Gott ihm eine Chance. Tatsächlich gedieh das Korn auf seinen Feldern prächtig unter der Wetterregie des Bauern. Nach der Ernte jedoch fielen beim Dreschen aus den Ähren keine Körner. Der gute Mann hatte an vieles beim Wettermachen gedacht, aber den Wind, den hatte er vergessen. Für Frucht tragende Ähren war eine Bestäubung durch Wind aber unbedingt notwendig.
Die Moral von der Geschichte war, dass wir Gott nicht ins Handwerk pfuschen sollten. „Vertraut Gott mehr als dem Menschenwerk.“
Mit diesen Worten schloss die Erzieherin ihre Lesung. Ein Raunen ging durch die Runde der fünfjährigen Zuhörer und ich spürte, ich war nicht der einzige, der die Geschichte total unglaubwürdig fand. Den Wind konnte man doch gar nicht vergessen. Da fehlte einem doch etwas. Selbst wenn dieser Bauer etwas vergessen hatte, dann hieß das noch lange nicht, dass andere Bauern den gleichen Fehler machen würden. Kindergartenkinder aus der großen Gruppe erkannten das.
Читать дальше