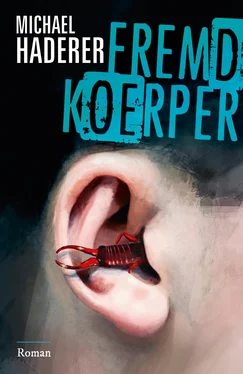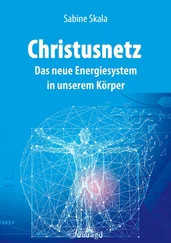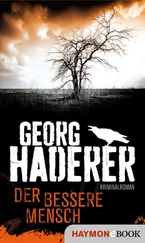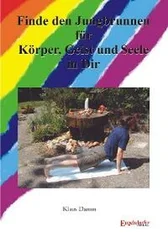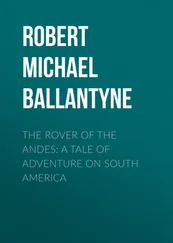Herb wollte etwas sagen. Etwas, das seine Niedergeschlagenheit adäquat ausdrücken würde. Aber er fand keine Worte. Ob ihm die Hausärztin überhaupt noch helfen konnte? Die Post hatte inzwischen sicher schon zu. Sein Geld konnte er frühestens am Montag abholen, wenn er es denn dann schaffte, rechtzeitig dort zu sein. Er saß einsam auf der kalten Bank der Haltestelle und beobachtete die vorbeifahrenden Autos dabei, wie sie mit ihren Rädern tiefe Furchen in den graubraunen Schneematsch pflügten.
Es vergingen wohl an die zwei Stunden, ehe sich für Herb wieder ein Fenster zur Realität öffnete. Alle fünf bis zehn Minuten hielt eine weitere Straßenbahn und die aussteigenden Menschen machten eine großen Bogen um diesen offenbar mit Drogen vollgepumpten, heruntergekommenen Typen. Jene, die sich an der Haltestelle einfanden, weil sie den nächsten Zug in Richtung Zentrum nehmen wollten, rümpften die verschnupfte Nase oder schüttelten aus sicherer Entfernung angewidert den Kopf. Herb bemerkte sie nicht. Ihre boshaften Kommentare konnte er wegen der Orgelmusik in seinem Kopf nicht hören. Bach spielte das Präludium nun schon zum hundertsten Mal. Er starrte mit weit aufgerissenen Augen ins Nichts. Ab und zu riss er seine Arme vor das Gesicht, als wollte er sich vor einem Angriff schützen. Ein Verrückter war er, für alle, die sich für normal hielten. Nach Meinung der echten Wiener, derer es nach Meinung der echten Wiener schon viel zu wenige gab, sah man in jüngster Zeit viel zu viele Verrückte frei herumlaufen. Die jüngste Zeit war eben viel zu liberal. Das hätte es früher nicht gegeben. Das war schon mal anders.
Und sie fühlten sich schließlich wie kleine Sieger, als Herb mit einem Mal von der Bank aufsprang und die Wolfgang-Schmälzl-Gasse zurück in Richtung Max-Winter-Platz spazierte, als wäre nie etwas passiert.
Das Stück Realität, das sich gerade wie ein flüchtiges Hoch zwischen zwei mentale Schlechtwetterfronten schob, gestattete Herb, halbwegs schnell und ohne weitere Komplikationen die paar hundert Meter bis nach Hause zurückzulegen. Franzi war wohl gerade mit einem Freier unterwegs oder erholte sich in ihrem Stammcafé vom Ungemach, das ihr Herbs Auswurf bereitet hatte. Ihr Standplatz war verwaist. Nur die halb verdaute Pizza klebte noch auf dem Asphalt.
Den geplanten Arztbesuch hatte Herb schon vergessen, ebenso wie sein Versprechen, bei seiner Nachbarin, Frau Laner, anzuklopfen. Als er sicher in seiner Wohnung angekommen war, legte er nur noch ein vertrautes Video in seinen VHS-Player und sich selbst auf sein altes Sofabett. Der Tag hatte noch nichts Gutes für ihn zu bieten gehabt. Mit diesem Film wollte Herb sein Schicksal endlich in bessere Bahnen lenken.
Sie musste wieder eingeschlafen sein, denn als Janis zu sich kam, waren ihre Fesseln so weit gelockert, dass sie ihre Hände und Füße davon befreien konnte. Es schien, als hätte Janis einen unsichtbaren Verbündeten. Auch die Zellentür stand einen Spalt offen, sodass ein schmaler Streifen Ganglicht es schaffte, auf den kalten Steinboden ihrer Zelle zu fallen und Janis den ersehnten Ausgang in die Freiheit zu markieren. Wer auch immer dafür verantwortlich war, hatte vermutlich auch die Blumen an ihr Bett gebracht. Um etwas Dankbarkeit zu zeigen, nahm sie das Johanniskraut aus der Vase und steckte es in die Tasche der grau-weiß-gestreiften Gefängnisjacke, die man ihr angezogen hatte. Vorsichtig schlich sie sich an die Tür heran. Es konnte auch eine Falle sein.
Janis riskierte einen Blick durch den Spalt auf den Flur. Quadratische senfgelbe Fliesen für den Boden, bläulich-grüne quadratische Fliesen an der Wand. Alle paar Meter sorgte eine schmucklose Neonröhre für grelles, kaltes Licht.
»Geschmacksdesaster!«, kam es Janis in den Sinn. Es schien in der einen Richtung keine Wachen zu geben, also wagte es Janis, den Kopf weiter rauszustrecken und die andere Seite des schmalen Ganges zu inspizieren. Auch nichts. Sie war allein. Der Flur musste schier endlos sein, denn trotz des gleißenden Neonlichtes konnte man nach beiden Seiten kein Ende ausmachen. Janis entschied sich, nach links zu gehen, besser gesagt, sie schlich nach links mit dem Rücken die Fliesenwand entlang. Zuerst nur ein paar Schritte auf Zehenspitzen, dann immer schneller werdend, bis sie schließlich lief, so schnell sie konnte, zuversichtlich, einen Ausgang zu finden.
Von Weitem schon sah sie die Tür. Das Licht im Raum dahinter war wärmer, soweit konnte man sich das durch die Milchglasscheibe vorstellen. Je näher Janis der Tür kam, umso größer wurde ihre Hoffnung auf Freiheit. Und als sie dieser Freiheit bis auf ein, zwei Meter nahe gekommen war und schon ihre Hand ausstreckte, um mit ihr den Türknauf zu fassen, erstarrte sie erschrocken und duckte sich aus dem Türbereich in die Ecke. Sie versuchte den Atem anzuhalten, um nicht entdeckt zu werden. Doch ihre Lungen verlangten nach dieser Aufregung dringend nach Sauerstoff. Janis kämpfte dagegen an. Jeder einzelne Atemzug schien ihr zu laut und mochte die Wachen alarmieren, deren Schatten sie durch die Scheiben schemenhaft erkennen konnte. Man hörte sie etwas murmeln, dann ein gehässiges Lachen, dann war es ihr, als stritten sie. Die Wachen schienen betrunken und aggressiv. Es war nicht ratsam, ihnen zu begegnen, und es war wohl aussichtslos, unbemerkt an ihnen vorbeizukommen.
Der Türknauf drehte sich. Jeden Moment würde eine Wache durch die Tür treten und sie dahinter kauernd entdecken.
Ängstlich trat Janis den Rückzug an. Behutsam und lautlos setzte sie ihre Schritte, um nur ja kein Geräusch zu verursachen, bis sie meinte, genügend Abstand zwischen sich und die Gefahr gebracht zu haben. Dann rannte sie los.
In diesem Moment entdeckte sie die Wache.
»Halt! Bleib stehen!«, schrie er ihr nach. »Sofort stehen bleiben!«
Er rief seinen Kollegen und beide hetzten ihr brüllend hinterher.
Janis rannte vorbei an ihrer Zelle durch den elendig langen Gang, ohne darüber nachzudenken, was sie auf der anderen Seite erwarten würde. Es gab keine Alternative, nur rennen, auch wenn sie auf eine neue Ungewissheit zusteuerte. Sie drehte mehrmals den Kopf nach hinten, um den Abstand zu ihren Verfolgern zu bestimmen. Doch die waren plötzlich stehen geblieben. Dort, wo die Fliesen an der Wand geendet hatten und von einer bemoosten Ziegelmauer abgelöst wurden, dort, wo anstatt der senfgelben Keramiken nun ein simpler gestampfter Lehmboden unter Janis Füßen war, dort an der Kante waren die beiden Wachen abrupt stehen geblieben und wagten sich nicht weiter. Als fürchteten sie, in einen Abgrund zu stürzen.
Janis drosselte ihre Geschwindigkeit. Sie war etwas verwirrt, doch auch zufrieden. Anscheinend hatte sie es geschafft, sich in Sicherheit zu bringen. Der Lehmboden fühlte sich kalt an unter ihren Füßen. Falls sie denn je Schuhe besessen hatte, mussten ihre Entführer sie ihr abgenommen haben. Die Ziegelmauer war feucht und stank nach fauligen Fischen. Statt der Neonröhren gaben nun ovale Baustellenlampen einen dürftigen Lichtschein ab, gerade hell genug, damit man den Mut nicht verlor, aber auch nicht ausreichend, um dem Gang seine gespenstische Atmosphäre zu nehmen. Kein Ort zum Verweilen.
Nach drei scharfen Kurven fand der Tunnel endlich ein Ende. Beinahe wäre Janis in den dunklen See gestürzt, der sich vor ihr wie ein riesiger Teppich ausbreitete. Gerade noch konnte sie sich, gefährlich schwankend, an einer Seitenleuchte festhalten. Eine geräumige Grotte breitete sich vor ihr aus, mit riesigen Stalaktiten, an denen Fledermäuse kopfüber hingen wie schwarze Früchte. Es war das Ende des Weges. Hier ging es nicht weiter.
»Endstation.« Janis verlor sich in tristen, fatalistischen Gedanken. Sie nahm die gelben Blumen aus der Tasche und roch an ihnen. Entmutigt setzte sie sich ans Ufer und begann still zu weinen. Wo war sie nur hineingeraten? Sie wusste nichts von sich, nichts von ihrer Vergangenheit, wusste nicht, ob sie denn Familie hatte, Kinder, Freunde oder wenigstens ein Haustier. Sie starrte auf den See. Er war schwarz. Schwarz wie fast alles hier. Die Wände der Grotte, die Fledermäuse. Die gelben Blumen in ihrer Hand wirkten, als hätte sie ein Maler als ein Zeichen letzter Hoffnung in die Landschaft gesetzt, ehe er sich sein tristes Leben nahm.
Читать дальше