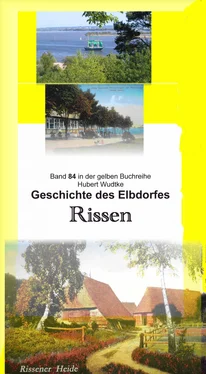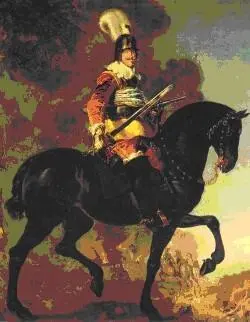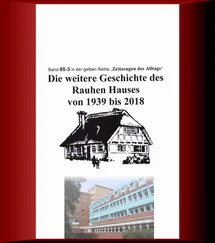Steuern werden zu Ostern auf Grund und Boden (Pascheschatz) und im September zur Erntezeit (Michaelisschatz) erhoben, der Zehnte wird vom Korn, Heu und von Mast- und Holzschweinen (im Wald gemästet) gefordert, pro Feuerstelle (Rauch) wird eine Rauchhuhnabgabe verlangt und in der Herrschaft sind „erbittete“ Dienste zu leisten: Arbeiten im Forst, im Moor, beim Bau von Brücken, Deichen und Wegen, bei der Ernte; diese Dienste können auch durch Geld abgelöst werden: Hand-, Spann- und Dienstgeld. Eine „Bede“ wird auch zur Unterhaltung der Gerichte erhoben.
An den Steuerzahlungen kann man ablesen, dass Rissen ein Bauerndorf von der Größe und Produktivkraft wie Wedel, Schenefeld oder Osdorf gewesen ist. Die Steuerlisten erfassen aber nur die Abgaben ans Amt Hatzburg nicht aber an das Hamburger Domkapitel.
Rissen um 1600 – das Schweineregister
Da es um 1600 noch keine Meldeämter oder Volkszählungen gibt, muss nun auf Umwegen herausgefunden werden, wer und wie viele Personen in Rissen, Tinsdal und Wittenbergen gelebt haben. Es klingt ein wenig anrüchig, wenn ausgerechnet im Schweineregister aus den Hatzburger Amtsrechnungen nach den Einwohnern von Rissen gefahndet werden soll. Aber dieses Register enthält die älteste mir zugängliche Personenliste von Einwohnern Rissens, die zur Grundherrschaft Pinneberg gehören. In dem Register von 1590 finden wir die Personennamen und ihnen zugeordnet die Anzahl der Mastschweine und die entrichteten Steuersummen.

Albrecht Dürer: Der verlorene Sohn bei den Schweinen 1496/97
Für Rissenwerden 21 Besitzer von Mastschweinen und 3 für Tinsdalgenannt, von diesen führen zwei Personen keinen richtigen Familiennamen. Dass alle Einwohner einen amtlichen Vor- und Nachnamen haben, ist erst eine Errungenschaft des ausgehenden Mittelalters und hängt mit dem Wachstum der Bevölkerung und der sich durchsetzenden Führung von Kirchenbüchern und Steuerregistern zusammen.
Die Namensbildung erfolgt nicht selten in Anlehnung an den Beruf wie bei Müller, Krüger, Bauer, Biermann, Dreier, Kleinschmied, Schmidt. In unserer Liste werden der Kuhhirte und die Kleinschmiedsche ohne Ruf- und Zunamen aufgeführt. Ob es sich bei der „Kleinschmiedsche“ um die Tochter von Elsabe Ellerbruch handelt? In der Liste können wir noch weitere Bekannte wieder entdecken: Klaus Biermann, Claus Dreier, Lüdemann. Viele der Namen lassen sich auch in den nächsten Jahrzehnten und Jahrhunderten finden.
Name (Zahl der Mastschweine):
Rissen
Jochim Grothe (19), Hans Wolter (14), Hans Moller (25), Hans Rambke (16), Hans Maes (20), Illies Kone (2), Michel Botthoip (12), Bartelt Langelo (13), Die Kleinschmiedsche (14), Claus Steer (2), Redar Maes (27), Cordt Honermann (3), Johan Eickhoff (34), Clauß Dreier (14), Clauß Bierman (16), der Kuhirte (2), Jürger Hünerman (3), Jürg Ellerbrock (4), Linnies Wagener (6), Jellies Kotare (3), Marx Pauls (3)
Tinsdal
Clauß Lüdeman (21), Cord Grothe (17), Catharina Ludemand (8 + 4 Ferkel)
Diese Liste dürfte fast alle Rissener Hofbesitzer aufführen und erlaubt es uns, ein wenig über die Gesamteinwohnerzahl von Rissen zu spekulieren und Fehlmeldungen oder Fehlformulierungen zurückweisen, wie etwa diese: „Noch 1610 zählte (Rissen) lediglich 19 Einwohner“ (Schröter: Die Elbvororte, Hamburg 1992, 73) oder auch diese Meldung aus der Werbebroschüre des Rissener Bürgervereins: „1610 Rissen hat 16 Einwohner und „1 Krog“.“
Die Liste nennt uns 24 Haushalte. Zu jedem Haushalt kann man im Durchschnitt 5-7 Familienmitglieder (die Eheleute, die Alten, die Kinder, die unverheirateten Verwandten) zählen. Vollhufner hatten darüber hinaus Knechte und Mägde im Haushalt. Ferner nennen diese Listen nicht die Einwohner, die keine Steuern entrichten mussten wie die Tagelöhner und meisten Häusler oder Besitzer von Freihöfen, wie es sie in Wedel und Sülldorf gab, oder die ihre Steuern nicht an die Hatzburg zahlen mussten.
Halten wir fest:
Rissen ist um 1600 ein größeres Bauerndorf mit mindestens 100, vermutlich aber eher mehr als 120 Einwohnern und dank ihrer Namen treten sie für uns aus dem Dunkel der Geschichte für ein paar Momente ins Helle unser kleinen Erzählungen.
Rissen ist ein Dorf auf sandigem Boden; die Bauern betreiben Schweinemast und Schafzucht und etwas Milchviehwirtschaft, wie die Straßennamen Kohdrift und Melkerstieg anzeigen. Rissens Arbeits- und Alltagsleben ist durch die Jahreszeiten, den rhythmischen Wechsel von Werk- und Sonntagen und durch das Kirchenjahr geprägt – Rissen ist um 1600 ein ruhiges Dorf in ruhiger Zeit. Ist es das?
Das nächste Jahrhundert wird für die Grafschaft Holstein große Veränderungen und manche Unruhe bringen. Die europäischen Herrscher verfolgen seit dem Beginn der Moderne verschärft nationale Großmachtpolitiken, führen lang andauernde Erbfolgekriege, nehmen Partei in den Religionskriegen, müssen Revolten (Böhmen) und Befreiungskriege (Niederlande gegen Spanien) hinnehmen und fahren zu Beutezügen über die Weltmeere. Diese Kämpfe und Eroberungen bleiben für die Grafschaft Holstein im 16. Jahrhundert noch Hintergrundsmusik, aber in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts ändert sich die politische Gesamtlage.
Turbulenzen in der Grafschaft Pinneberg – 1616 – 1622
Seit 1616wird die Grafschaft Pinneberg durch die Großmachtpolitik des Dänenkönigs Christian IV, der Anspruch auf die Herrschaft Pinneberg erhebt, in Turbulenzen gestürzt.

König von Dänemark: Christian IV – (1643 Karl von Mander)
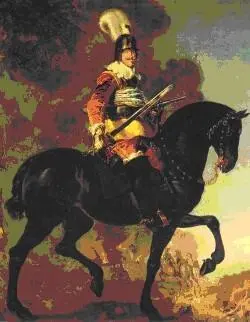
König von Dänemark: Christian IV – (1625 Pieter Isaacsz)
Der deutsche Kaiser Ferdinand II bestätigt zwar Graf Ernst III zu Holstein in seinen Rechten, kann ihm aber militärisch nicht zu Hilfe kommen, als Christian IV seine Soldaten in die Grafschaft Pinneberg einrücken lässt.
Die Einquartierung der Soldaten führt dabei zu Drangsalierungen der Bevölkerung, wie ein amtliches Protokoll nach ihrem Rückzug für Wedel festhält.
Johan Ladigs sagt aus, dass „ sie ihn, seine Frau und Kinder auß dem Haus gejagt. Auch seinen Vatter der 100 weniger 4 Jahre alt, auf sein Bett gezogen und ihm etliche Streiche mit der bloßen Wehr über den Kopf gegeben“ Steffen Beermann wurde von den „Soldaten gahr jemmerlich geschlagen das er schier in seinem eigenen Bludt ersticken müssen“. Hans Röttkers Wittwe gibt zu Protokoll, „dass sie, obwohl ihr Mann schwer erkrankt war, den Cornet Burleben mit 6 Personen und 7 Pferden habe ins Quartier nehmen müssen. Hans Roettker ist wegen des vielen Getümmels und Blasens während der Einquartierung gestorben. 522 Reichsthaler seien ihr an Kosten für die Einquartierung entstanden. Der Cornet gab der Wittwe die Zusage, dass ihr die Kosten erstattet würden. Beim Verlassen des Quartiers gab er ihr 11 Thaler, bevor er davonritt “.
Für zwei Taler (große Silbermünzen) bekam man zwei Scheffel Korn (ca. 100-150 Liter), der Jahreslohn für eine Köchin betrug 10 Taler, für einen Diener 24 Taler; ein Ratsherr in den Städten verdiente allerdings 1.200 Taler. Ob Soldaten auch in Rissen Quartier genommen haben, können wir nicht sagen. Erst 1622 kann Graf Ernst durch erhebliche Zahlungen an den dänischen König die Besetzung beenden.
Читать дальше