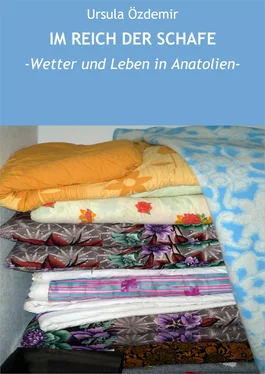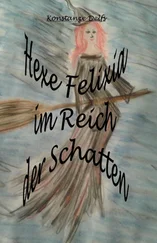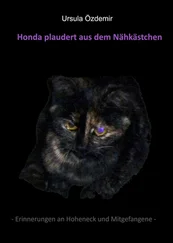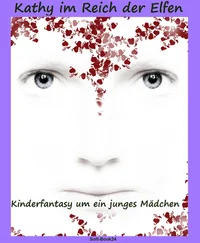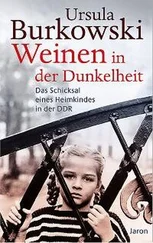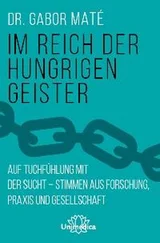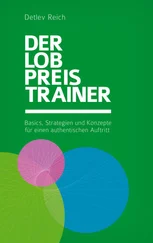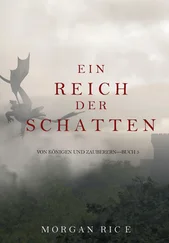Der Wasservorrat in der Küche ist fast aufgebraucht. Ich schiebe den Vorhang des Küchenregals beiseite und greife zwei massive, innen mit Zink ausgewischte Kupferkessel aus dem Regal. Mit diesen Behältnissen, deren Öffnung weiter ist als die eines Wassereimers, nur ganz so tief sind sie nicht, - mit diesen Behältnissen also, eins in der rechten Hand hinter mir, eins in der linken Hand vor mir, bahne ich mir einen Weg von der Küche durch den überfüllten Innenraum des Hauses – eine Art Atrium - in den Korridor und von dort auf die Veranda, nehme mit einem perfekten Kreuzschritt die Latschenparade und falle dann lockeren Fußes die fünf Steinstufen von der Veranda hinab. Auf dem Hof steht wie ein Gast, der vor der Tür bleiben mußte, rot bis rostig der Traktor. Ungerührt erträgt er die Dorfkinder auf seiner Motorhaube, am Lenkrand, hinter sich auf dem Hänger, unter dem Hänger.
Mitten im emsigen Kletterkrabbel entdecke ich alle jüngeren Kinder von Hassan, der von allen Dorfbewohnern Wachtmeister Hassan genannt wird, weil seinen wachsamen Augen nichts entgeht. Und das ist gut so, immerhin nennt er 15 Kinder sein eigen, und da sollte er die Übersicht behalten. Der älteste Sohn von seiner ersten Frau ist inzwischen selbst Familienvater. Er lebt und arbeitet seit Jahren - wie Dutzende Männer aus diesem Dorf - in Frankreich. Gut zehn Monate im Jahr lassen sich diese Männer in einem französischen Bergdorf von der Arbeit fesseln, aber in den Sommermonaten setzt für fünf Wochen ihr Exodus zu den Strohwitwen und Kindern am heimischen Herd ein. Doch lange ehe Hassan’s Sohn nach Frankreich auszog, um das Glück zu finden, starb Wachtmeister Hassan plötzlich die Frau weg. Da stand damals der urwüchsige Bauer, von den Haarwurzeln bis in die Fußzehen Pascha, allein mit seiner gebieterischen Anspruchshaltung, die auf einmal in Irritation verpuffte. Er rappelte sich auf und beschloß, nie wieder in eine solch fatale Situation zu geraten und nahm sich gleich zwei Frauen, eine nach dem Gesetz, eine nach der Tradition. Gesetz und Tradition in der Türkei – eine zweigleisige Realität, zumindest beim Thema Ehe. Als in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts der Vater der Türkischen Republik, Atatürk, seinem Volk den europäischen Herrenhut als staatliche Doktrin verordnete, worauf die Fez-Fans am Bosporus teils im Schock lagen, teils auf die Barrikaden gingen, erließ er auch das Gesetz zur Einehe. Dieses Gesetz ist heutzutage in anatolischen Köpfen bewußt, denn die Standesämter in den Städten lassen die Registrierung nur einer Ehefrau zu; aber die Furchen der Tradition in den gleichen Köpfen lassen sich dadurch nicht auslöschen – die Tradition lebt gleich einem fruchtbaren Acker in Bauernrüben fort, lebt mit dem Glauben an den Koran, der dem Mann maximal vier Frauen zugesteht, sofern er sie ernähren kann.
Hassan nahm sich also zwei Frauen. Er konnte zwei Frauen ernähren. Er hatte zu der Zeit nämlich den einzigen Laden im Dorf. Eigentlich ist es kein richtiger Laden, sondern ein Wohnraum in seiner Hütte am Berghang, in dem er Waren vorhält: Kartoffeln, Melonen, Äpfel, Tomaten, Rosinen, Olivenöl, Streichhölzer, Zigaretten, Johannisbrot, Kernseife und Bonbon-Wurst, eine Zähne brechende Süßigkeit in Wurstform. Er handelt mit Vieh und Getreide. In seinem Stall hinter der Hütte stehen Milchkühe, gackern Hühner und gurgeln Truthähne. Vier Kilo Weizen von seinem Acker tauscht er z. B. gegen ein Kilo Rosinen. Fährt ein Lastwagen mit Lebensmitteln auf den Moschee-Platz des Dorfes, so kauft er vom Wagen herunter Waren ein und läßt sie von Kindern den Hang hinauf in seine Hütte tragen. Bauern können bei ihm ohne Geld einkaufen, er nimmt unter anderem Schafwolle in Zahlung, die er abwiegt und später gegen Geld in der Stadt verkauft.
Nun nimmt er drall und schlitzohrig ein Sitzkissen in einem der Gästezimmer ein, quillt über seine prallen Schenkel, wie immer ein Bein ausgestreckt, das andere untergeschlagen, und zerquetscht mit seinem Rücken die Kissen an der Wand. Seine beiden Frauen, deren Gesichter durch Haushalt, nicht endende Fruchtbarkeit, Feld- und Stallarbeit um zwanzig Jahre vorgealtert sind, glucken Seite an Seite in einem Gästezimmer nebenan, einem Empfangsraum für das weibliche Geschlecht. Bald werden sie wieder singen. Man braucht sie nur darum zu bitten, und schon heulen sie ihren weitgezogenen Singsang durch die Zähne, weitgezogen wie die Berge Anatoliens.
Die Teegläser werden für die vielen Gäste nicht reichen. Also Bewirtung in mehreren Phasen ist angesagt. Erst wird den Herren Tee serviert. Nach dem zwischenzeitlichen Abwasch werden dann die Frauen mit neu aufgebrühtem Tee bewirtet. Das ist die korrekte orientalische Reihenfolge für das Tee-Ritual bei Gläsermangel.
Ich lasse den beturnten Traktor hinter mir und trete aus dem Hoftor. Die Henkel der Kupferkessel quietschen bei jedem Schritt in ihren Aufhängungen. Oberhalb der Dorfstraße befindet sich auf einer kleinen Anhöhe die Wasserstelle für die im Umkreis lebenden Familien. Dort ragt aus einem fast mannshohen Steinquader ein kinderarmdickes Rohr, aus dem sich klares Quellwasser ergießt und auf den darunter befindlichen Beton klatscht. Von hier fließt das Wasser leicht abwärts in eine Viehtränke, deren Mauern bis hinunter zur Dorfstraße reichen. Beim Füllen der Wassergefäße muß man aufpassen, daß man nicht mit einem Fehltritt von der kleinen Betonfläche rücklings in die Tränke fällt. Der Wasser spendende Steinquader ist oben mit einer flachen Steinplatte abgedeckt. Zu seinen beiden Seiten hockt je ein kniehoher Steinblock. Meine Kupferkessel werde ich nicht so bald füllen können, denn der sprudelnde Quell ist dicht belagert. Über einem der seitlichen Steinblöcke saust eine breite Holzkeule durch die Luft, wuchtet gnadenlos in eingeseifte Wäschestücke. Ein zwölfjähriges Mädchen schwingt die Keule, mal auf eine Strickweste, mal auf ein anderes Kleidungsstück. Die ausreichend verdroschene Wäsche wringt es über dem Erdboden aus und legt sie Stück für Stück oben auf den Rand der Steinplatte. Neben den gewursteten Wäschestücken überragt ein verchromtes Tablett, das mit den größten Kuchenblechen Europas konkurrieren kann, die Steinplatte. Eine Bäuerin stapelt darauf ihre Töpfe und Pfannen, die sie gerade mit Sand ausgescheuert hat. Unablässig rückt sie dabei ihr Kopftuch zurecht, das ihr in der gebückten Anspannung ständig verrutscht. Zum Schluß wäscht sie sich Hände und Gesicht. Darunter spülen Mädchenhände flink die Seife aus soeben ausgewrungenen Wäschestücken aus. Ein anderes Weib mengt seine schwarzen Gummilatschen unter den schon doppelt genutzten Wasserstrahl. Frisch wassergetränkte Wäschestücke werden auf dem Steinblock linkerhand ausgebreitet, auf dieser Art Waschklotz mit Kernseife eingeseift und durchgewalkt. Und wieder kracht die Keule in die Wäsche, kollert mit dröhnendem Echo in die umliegenden Gehöfte. Die Herrinnen des verchromten Riesentabletts und der naß-sauberen Gummilatschen haben die Wasserstelle geräumt. Gegen eine plötzlich aufkommende Brise klettern sie in ihren Pluderhosen gleich farbenfrohen Windbeuteln auf den Berghang hinter der Wasserstelle, hinauf zu ihren Hütten. Ein grünes Samtkleid über scheckiger Pluderhose beugt sich jetzt zum Wasserstrahl. Dieser verschwindet alsbald in einem Tonkrug, füllt ihn bis zum Rand auf. Anschließend wird eine verstaubte Plasteschüssel ausgewaschen und erstrahlt wieder in leuchtendem Rot, eine Plasteschüssel vom Ausmaß eines Autoreifens. Solch große Plasteschüsseln dienen unter anderem als Unterteil der asiatischen Dusche, in das man sich hineinstellt oder –setzt, um sich aus einem gut einen Liter fassenden Henkelpott mit warmem Wasser zu überschütten, das man aus einem Bottich oder einer anderen Plasteschüssel schöpft. Ein Mädchen mit goldenen Armreifen vom Handgelenk bis hinauf zum Ellenbogen verdrängt die Madame in Samt und wäscht einen flachen Strohbesen aus.
Читать дальше