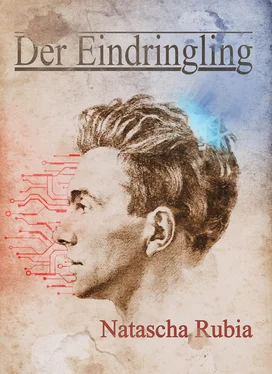Diesen Donnerstag wartete ich, am Marterpfahl der Klassentafel gebunden. Alle Trafos meiner Seele sammelten sich zur knisternden Elektrizität eines Hochspannungswerkes. Sie bemerkte die Anspannung in der Luft, sah sie an meiner Körperhaltung. Unsere Verlegenheit ließ uns im Klassenzimmer verweilen, in der Atmosphäre des Moments verharren, als hätte man uns hinter dem Pult an einem unsichtbaren Elektrozaun angepolt. Sechs Monate währte das Semester. Wir konnten nicht mehr vor- noch zurück. Ich fühlte mich eingesperrt, gefangen in meiner Brust. Das Klassenzimmer mutierte zu meiner Gefängniszelle.
Still beobachteten wir gleichzeitig die Schüler bei ihren Buben-Mädchen-Spielen. Wir wußten dabei, dass wir dasselbe sahen. Zumindest schien es so. Schon lange sprachen wir miteinander ohne ein Wort zu wechseln. In der Stille verschmolz uns der Druck zu einer Person. Da platzte ich heraus:
„Meine Eltern haben mich als Mädchen erzogen“, fing ich an.
„Mein Bruder war ja schon da und meine Mutter wollte unbedingt eine Tochter.“
Es war die Wahrheit und dennoch wirkte es, als entschuldigte ich mich mit einem fadenscheinigen Vorwand dafür, passiv in meinem unerkannten Eck zu verweilen, während ich sie jede Kommunikationsarbeit leisten ließ.
„Witzig“, konterte sie und beobachtete fasziniert mein feminines Hüfte-Wiegen, welches gleichzeitig zu ihr hingezogen und abgestoßen schien, eine schlangenhafte Unentschiedenheit meines stets am Wohlwollen des Gegenüber zweifelnden Gemütes.
„Meine Mutter erzog mich als einen Jungen auf einer Bubenschule. Sie wollte unbedingt einen Knaben. Dabei gebar sie zuerst meine ältere Schwester.“
Die Vorstellung war wirklich komisch. Ein Rollentausch.
Ich musste sie interessieren mit einem mystischen Thema. Ich versuchte es mit dem bisschen Esoterik, das ich beiläufig aus Frauenmündern oder Magazinen aufgeschnappt hatte.
„Meine Persönlichkeitszahl ist eine 9“, prustete ich unzusammenhängend hinaus.
„Die NEUNER-Persönlichkeit ist ein Idealist und Visionär. Diese Menschen haben verschiedenste starke, oft extreme Erlebnisse in ihrem Leben, können dadurch aber zu echter Weisheit und Grösse gelangen“, brüstete ich mich wie der Enterich am Sonntag morgen.
Sie war verdutzt über meine ungebetene Eröffnung. Das Thema war ihr unbekannt und mein bisschen Metaphysik ganz offensichtlich vom Flohmarkt. Daneben gegriffen. Sie schielte unbeholfen auf einen Notensatz, den ich am Pult liegen gelassen hatte.
„Sie spielen auch Musik?“, wandt sie ein und rettete mich damit galant aus meiner Verlegenheit.
„Posaune,“
„Klassik?“
„Jazz“, aber ich höre gern Klassik. „Als Orchestermitglied hätte ich als Posaunist zu wenig zu tun, da wäre mir fad“, gab ich wahrheitsgetreu zu. „Da kommt ein Bläser nicht so oft zum Zug, wie etwa ein Geiger.“
„Da haben Sie wohl Recht“, meinte sie, „Bläser spielen meist nur kurze Sequenzen. Bei uns zu Hause wurde ein Leben lang Klavier gespielt“, setzte sie hinzu. „Bach, Mozart, Bruckner und Beethoven...“
Nun hatte ich einen Ansatzpunkt. Konzerte waren das einzige gesellschaftliche Ereignis, welches ich abseits meiner Lehrverpflichtung, die ich privat als Posaunenlehrer fortsetzte, pflegte. Nachdem man die meiste Zeit still saß oder stand, blieb nicht viel Platz für innige Konversationen und ich konnte mich im Auditorium in mein geliebtes Schweigen hüllen. Reden mußte ich als Lehrer genug. Mit dem gebührenden Abstand eines Vorgesetzten. Und was sagten schon Worte? Konnte man nicht mit Worten das Gegenteil ausdrücken, was man im Herzen empfand? Waren es nicht nur Floskeln voller Lüge im Samtgewand?
Nächsten Donnerstag schickte ich alle Kinder früher hinaus. Es war schon spät, aber ich sah ihren Sohn draußen auf seine Mutter warten. Sicher würde sie noch kommen und niemand könnte mich davon ablenken, eine längere Unterhaltung anzuknüpfen. Da hörte ich schon ihre hohen Absätze auf dem alten Steinfußboden im hallenden Gang. Indem ich meinen Oberkörper ihr zudrehte, fing ich sie auf. Sie konnte mir nicht entkommen.
„Heute ganz alleine?“
„Ja. Die Racker sind Gott sei Dank alle früher fertig geworden“, gab ich vor.
„Dann müssen Sie alles selbst aufräumen?“ fragte sie.
„Nicht der Rede wert“, meinte ich. „Das mache ich jeden Tag. Da kann ich mich einstellen auf das Konzert heute abend“, schob ich mit einem aufmunternden Lächeln ein. Sie kam mir zur Hilfe und wir räumten einträchtig die liegengebliebenen Malsachen in die Regale.
„Was spielen Sie denn?“
„Ich höre diesmal zu. Bruckner im Musikverein.“
„Bruckner. Auf der Orgel?“
„Nein. Die Philharmoniker spielen heute die 5te Symphonie, die Phantastische.“
„Die Philharmoniker? Die habe ich früher jede Woche gehört,“ lächelte sie in Nostalgie getaucht. „Dort war ein Geiger, den ich einmal interviewt habe. Es sind die Personen, die einen mit Orten verbinden,“ wähnte sie in Anspielung auf meine Homophobie.
Ihr Sohn rief sie ungeduldig hinaus.
„Ich bin immer am Stehplatz, da kann ich auch nach der Pause hineinhuschen. Ich weiss ja nie, wann ich mit dem Unterrichten fertig bin“, setze ich rasch hinzu, bevor sie verschwand.
Ich hoffte, sie würde kommen.
Und sie kam. Ich werde den Tag nie vergessen. Es war der 22. Februar und doch schien es mir wie der erste Frühlingsabend. Am Karlsplatz hing lauwarm die Sonne über den Baumkronen und verwandelte im Zwielicht den flachen Teich vor der ausladenden Kirche in ein munteres Stelldichein. Fidel scharten sich Touristen und Studenten der angrenzenden Technischen Universität in kleinen Gruppen auf den das Wasser umsäumenden Treppen vom lauen Abend animiert zusammen, an denen ich nun frisch parfümiert mit dem Rad vorbeisegelte, meiner Gewohnheit nach eine Stunde zu spät zum vis à vis gelegenen Musikverein.
Mein Zeitplan richtete sich nach dem Anfang der grossen Symphonie. Der grosse Saal galt als komplett ausverkauft. So war mir die Pause willkommen, zwischen Sektgläsern und belegten Kaviarbrötchen hindurch unbemerkt den oberen Stock zu erklimmen. Grau in grau sassen die Herren in den Sitzreihen des Parketts, getrennt nur durch die dezenten Tupfer der altmodisch glitzernden Roben ihrer betagten Begleiterinnen. Schnell und gewandt stürzte ich von links in das hintere Areal des goldenen Musikvereinssaales.
Er schließt oben mit einer Holzkacheldecke und zwei kleinen Ventilatoren ab. Ein Hohl-Geschoss unter dem Parkett-Boden sorgt – ähnlich wie bei einer Geige – für einen Resonanz-Raum. Genauso lässt die Saal-Decke, die nicht einfach aufliegt, sondern am Dachstuhl aufgehängt ist, den Klang im Saal vorteilhaft schwingen. Auf den kunstvoll gearbeiteten quadratischen Deckenpanelen wiederholte sich die Laute und der Schwan in ornamentaler Abwechslung – sinnbildliche Attribute der griechischen Minerva – in Indien der Saraswati – Göttin der Kunst und der Musik, die im Großen Saal als goldene Statue auf beiden Seiten 16 mal die Seitenbalkone trägt. Die Japaner haben versucht, den Klang des Saales in minutiöser Nachbildung zu kopieren – vergeblich. Sie haben die Rechnung ohne die Minerva gemacht. Sie gibt hier den Ton an.
Im Moment, wo ich nach dem Halbzeitgetummel in die Mitte des rückwärtigen Raumes husche, sehe ich Saskia schon und laufe freudig auf sie zu. Für gewöhnlich stürzte ich alleine und argwöhnisch in diese Dunkelheit. Nun erhellte mich ihr Gesicht.
„Begrüße Sie“, meinte sie gut gelaunt. „Am Stehplatz? Aber stehen Sie nicht sowieso den ganzen Tag in der Schule? Da muss ich Ihnen das nächste Mal einen Sitzplatz kaufen. Heute sitzt meine Freundin dort, sie ist schwanger.“
Sie deutete auf eine junge, nette Frau in einem schwarz-weiss-geblühmten Kleid in der letzten Sitzreihe. Sie erhob sich und grüsste. Ein einfaches, nicht wenig hübsches, natürliches Mädchen. Dass sie vom Land war, merkte ich am Akzent. Ihr Gesicht hatte ein angenehmes Leuchten, stärker noch, als ich es von Hochschwangeren gewohnt war.
Читать дальше