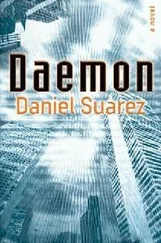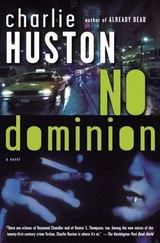Daniela Hochstein - Daimonion
Здесь есть возможность читать онлайн «Daniela Hochstein - Daimonion» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на немецком языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Daimonion
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Daimonion: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Daimonion»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Diese Geschichte erzählt von Leben und Tod, Gut und Böse, Liebe und Hass und insbesondere von den Facetten dazwischen…
Daimonion — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Daimonion», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Schließlich sortierte ich meine Glieder und setzte mich auf. Ich wollte meine Hand auf den Boden aufstützen, um aufzustehen, da berührte ich jedoch zufällig etwas, das sich ganz und gar nicht wie der erwartete Steinboden anfühlte. Überrascht blickte ich herunter und erschrak.
Rings um mich herum kauerten mindestens zehn dieser hässlichen, fledermausartigen Kreaturen, die mir noch vor zwei Nächten mit ihren gierigen Bissen zugesetzt hatten. Diesmal allerdings machten sie keine Anstalten, mich damit zu quälen. Vielmehr waren sie um mich versammelt wie ein Rudel Wölfe um ihr Leittier. Reglos hockten sie da und beobachteten mich neugierig aus dutzenden Augenpaaren. Ein Anblick, der mich eigenartiger Weise anrührte.
`Ihr wisst, was ich bin, nicht wahr?´, sagte ich zu ihnen, wie ein einsamer Mensch, der mit seinem Hund spricht, und meine Worte hallten seltsam verloren von den felsigen Wänden wieder.
Natürlich antworteten die Wesen nicht, aber dennoch gaben sie mir das Gefühl, trotz meiner verachtenswerten Natur, Zuneigung für mich zu empfinden (sofern Tiere zu so etwas überhaupt in der Lage sind). Und das wollte etwas heißen. Denn nicht einmal ich mochte das, was ich nun war...
Plötzlich fröstelte ich. Jedoch nicht aufgrund der niedrigen Temperatur, die in der Höhle herrschte. Die machte mir nichts aus. Nein, dieses Frösteln kam tief aus mir selbst heraus und kroch unaufhaltsam wie eine eisgraue Spinne in jeden Winkel meines Körpers. So eng ich konnte, zog ich meine Knie an mich heran und legte meine Arme darum, als könne ich mich dadurch dieser inneren Kälte wenigstens ein bisschen entziehen. Ich muss aber wohl nicht erwähnen, dass es mir nicht wirklich gelang.
Ich sehnte mich nach jemandem, dem ich von all diesen Ereignissen hätte erzählen können. Oder wenigstens jemandem, der einfach bei mir war, um mir Mut zuzusprechen. Ich dachte an Elisabeth und meine Eltern. Ich dachte daran, wie schön es wäre, nun bei ihnen zu sein.
Aber so, wie es jetzt war, so, wie ich jetzt war, wäre es so tatsächlich schön? Was würde meine Familie wohl von der Kreatur halten, zu der ihr Bruder und Sohn geworden war? Würden sie mich nicht letztendlich dafür verabscheuen und am Ende verstoßen?
Oder noch viel schlimmer: was würde geschehen, wenn ich dem Drängen des Dämons nach Blut nicht länger standhalten konnte und meine Familie gar zuletzt tötete?
Nein, ich konnte nicht zu ihnen zurückkehren! Nicht so!
Wohl oder übel blieb mir vorerst nichts anderes übrig, als für mich allein zu bleiben. Allein mit meinem einzigen, dafür aber umso treueren Begleiter: meinem Durst. Ruhelosen, unbeugsamen, lüsternen, hungrigen Durst. Einem Durst, wie ich ihn ganz und gar nicht spüren wollte! Würde es wohl je wieder eine Nacht geben, in der ich einmal ohne diesen unheilvollen Durst erwachen durfte?
Mit zusammengepressten Lippen vergrub ich den Kopf in meinen Armen und merkte, wie sich Tränen hinter meinen Lidern sammelten. Kalte Tränen... War denn gar nichts an mir mehr warm? Würde ich nun für immer auf das Blut von Menschen angewiesen sein, um mich lebendig und warm anzufühlen, während meine Opfer ihr Leben dafür hingeben mussten?
Eine furchtbare Trübsal nahm auf einmal von mir Besitz und drückte mir mit ihrer mächtigen Faust die Kehle zu, sodass ich kaum noch in der Lage war, zu schlucken. Schließlich ertrug ich diese Enge nicht mehr länger und ließ meinen Tränen ihren Lauf. Und als hätten sie schon viel zu lange auf diesen Moment gewartet, schossen sie plötzlich hervor wie ein unaufhaltsamer Strom aus Bitterkeit.
Ich weinte so lange, bis von meinem Berg aus Trauer bloß noch ein hohles Gefühl in meinem Bauch übrig geblieben war. Zuletzt saß ich wie betäubt da und beschloss, meinem Durst heute Nacht nicht nachzugeben. Ich wollte kein Mörder sein! Vielleicht würde ich sterben, wenn ich nichts mehr trinken würde... Ja, fast hoffte ich es! Und so legte ich mich, meiner schauderhaften Existenz überdrüssig, auf die Seite, rollte mich zusammen, schloss die Augen und versuchte, in den Schlaf zu finden.
Obwohl mir dies zwar nicht gelang, so blieb doch immerhin mein Kopf leer. Keine Gedanken, keine Gefühle, bloß ein Zustand des unbewussten Schwebens, in dem ich bis zum erlösenden Morgen verharrte.
Am nächsten Abend wiederholte sich das gleiche Spiel. Wieder erwachte ich und war umlagert von meinen neuen Gefährten. Wieder brannte und wühlte der Durst, diesmal allerdings fordernder. Wieder gab ich ihm nicht nach, sondern blieb auf dem kalten Höhlenboden liegen, die Augen ins Nichts gerichtet, den Kopf taub, bis der kommende Tag mich wieder von jeglicher Wahrnehmung befreite.
Als ich am dritten Abend erwachte, war ich noch durstiger als zuvor. Ich war kaum noch in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen, so sehr beherrschte mich das Verlangen nach Blut. Aber auch diese Nacht beabsichtigte ich, nicht auf die Jagd zu gehen, so schwer es mir auch fiel. Ich war immer noch geistesgegenwärtig genug, um mir das Töten von Menschen – die ich noch immer als meinesgleichen betrachtete – zu versagen. Allerdings merkte ich, dass mein Körper zunehmend schwächer und mein Geist unkonzentrierter wurde, bis ich bald nur noch vor mich hindämmerte und immer häufiger von Phantasien heimgesucht wurde. Es tauchten Bilder von blutenden Wunden vor mir auf, die ich mit meinen Fangzähnen weiter aufreißen und deren Blut ich auflecken wollte. Das Blut floss, erst in Rinnsalen, dann in Bächen und irgendwann in Strömen. Ich geriet zunehmend in ein Delirium, bis ich irgendwann nicht mehr recht zwischen Phantasie und Wirklichkeit unterscheiden konnte. Wie ein verstörtes Tier kauerte ich auf dem Boden und begann verzweifelt, mich selbst in die Arme zu beißen und mein eigenes Blut zu trinken. Ich glaubte schon, nun bald wahnsinnig zu werden. Doch da brach bereits der neue Tag an, begleitet von dem ewig geduldigen Schlaf, und kam dem Wahnsinn letztendlich zuvor.
Dafür aber trieb mich der Irrsinn umso gnadenloser in der folgenden Nacht.
Ich schlug die Augen auf und war nicht mehr ich selbst. Wie eine ausgehungerte Bestie sprang ich auf, kletterte in Windeseile aus der Grotte heraus und rannte in die Nacht hinaus, auf der besessenen Suche nach Menschenblut. Meine ohnehin schon empfindlichen Sinne übernahmen dazu die Führung mit übernatürlicher Schärfe. Von dem puren Instinkt eines Raubtiers gesteuert, spürte ich meine Opfer auf und fiel über sie her. Dabei machte ich keine Unterschiede zwischen ihnen. Jeder Mensch, der leichtsinnig genug war, sich nach Einbruch der Dunkelheit noch außerhalb der Stadtmauern herumzutreiben, war mir recht. Ich habe dabei keine klare Erinnerung an irgendwelche Einzelheiten. Ich weiß nicht einmal, wie viele Menschen ich in jener Nacht tötete - oder sollte ich besser sagen: abschlachtete?
Aber irgendwann hörte es dann endlich auf. Die Bestie war satt. Mein Verstand klarte auf, wie der Himmel nach einem schweren Gewitter, und nun durfte ich mir die Reste dessen betrachten, was ich angerichtet hatte.
Ich schaute mich um, als wäre ich gerade erst aus einem schlafwandlerischen Albtraum erwacht und war entsetzt über das, was ich vor mir erblickte.
Vor mir lagen drei grausam zugerichtete Leichen von Menschen, die dem äußeren Anschein nach – oder dem, was noch davon übrig war - keine bösen Absichten oder Gedanken gehabt hatten, als sie unglücklicherweise meinen Weg kreuzten. Ich hingegen war mit ihnen in meinem Blutrausch nicht zimperlich umgegangen. Einem Mann hatte ich die Kehle so zerfetzt, dass der Kopf abgerissen neben seinem Körper lag. Einem weiteren Mann hatte ich, wie es aussah, sämtliche Knochen, einschließlich des Genicks gebrochen. Er lag schneeweiß und völlig verdreht am Boden. Die Dritte im Bunde war eine Frau. Ihr hatte ich den Brustkorb auf und das Herz herausgerissen, welches nun, bloß noch ein schlaffes Häuflein Fleisch, leergesaugt neben ihr lag.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Daimonion»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Daimonion» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Daimonion» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.