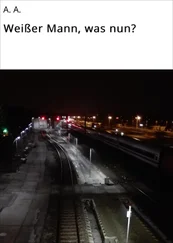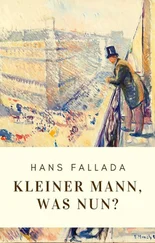Joseph Fröhlich, ein hoch angesehener und von manchen auch gefürchteter Richter, erfährt kurz vor seiner Pensionierung, dass er Krebs habe. Seine Lebenserwartung beträgt allenfalls noch ein Jahr.
Er beschließt, sich weder operieren zu lassen noch sich einer Chemotherapie zu unterziehen. Den Rest seiner Tage will er im warmen Süden verbringen und um kein Pflegefall zu werden, rechtzeitig selbst Hand an sich legen.
Ohne Verpflichtungen gegenüber anderen will er sein gesamtes Vermögen „durchbringen“ und dann selbstbestimmt sterben.
Insbesondere seine Ehefrau Helene, die nichts von seiner Krebserkrankung weiß, soll ihn auf keinen Fall pflegen müssen. Er sucht deshalb einen Scheidungsgrund und findet ihn auch.
Es kommt jedoch alles ganz anders.
Kleines Vorwort
Den geneigten Leserinnen und Lesern dieses Buches sei vorab versichert, dass die Leidensgeschichte, die ich berichte, nicht völlig frei erfunden ist.
Joseph Fröhlich gab es wirklich, nur sein Name ist geändert.
Ich habe ihn sehr gut gekannt und zwar so gut, dass ich alles so berichten kann, als wenn ich es selbst erlebt hätte.
Auch seine beiden wunderbaren Frauen habe ich gekannt und kann sie bestimmt zutreffend beschreiben.
All das versichere ich, so wahr ich Herbert E. Große heiße.
Letztlich bitte ich meine französischen Leser um Verständnis dafür, dass ich fast alle französischen Worte und Begriffe „eingedeutscht“ habe.
Narbonne im Sommer 2016
Der Anfang der Endzeit
„Der Herr Professor bittet Sie, sich noch 10 Minuten zu gedulden. Ein Notfall verlangt seine Anwesenheit“, sagte die Sekretärin.
„Können Sie und der Herr Professor sich nicht einmal etwas Neues einfallen lassen, sich zu entschuldigen?“, fragte ich.
„Herr Fröhlich, wenn ich nicht wüsste, dass Sie und der Chef gute Freunde sind, würde ich Ihnen das genau erklären.“
„Lassen Sie es. Man musste schon in der Schule immer auf ihn warten, ein schrecklicher Mensch, Ihr Chef. Aber eins muss man ihm lassen, er hat immer attraktive junge Sekretärinnen. In meinem Vorzimmer sitzen stets nur alternde Beamtinnen. Aber ich bin dafür seltener im Büro als Ihr Chef.“
„Darf ich Ihnen eine Tasse Kaffee machen, Herr Fröhlich?“
„Das ist eine sehr gute Idee. Aber bei dem, was mich gleich erwartet, wäre mir ein großer Cognac lieber.“
Die Sekretärin lächelte ganz lieb, stellte mir eine Tasse Kaffee und einen Cognac auf den kleinen Tisch, an dem ich wartend saß. Sie wusste ganz genau, dass sie mich nicht zu trösten brauchte. Trotzdem versuchte sie verzweifelt, mich in ein Gespräch zu verwickeln, um mich abzulenken.
Nach kurzer Zeit wurde sie erlöst und der Professor öffnete die Tür zu seinem Zimmer.
„Hallo Jo, komm rein!“
In seinem Büro fragte er, wie weit meine Scheidung von Helene sei.
„Alles läuft problemlos. Nun hör aber auf zu schwätzen und um den heißen Brei herumzureden. Wie sehen die letzten Laborwerte aus?“, fragte ich ziemlich grob, um diesen Termin ganz schnell hinter mich zu bringen.
„Jo, für eine Operation ist es fast schon zu spät, jetzt hilft nur noch ...“
Manfred war froh, unterbrochen zu werden, als der Notruf erklang. Der Notfall konnte jedoch an einen der Oberärzte delegiert werden.
Bevor er mit seinen Ausführungen wiederbeginnen konnte, fragte ich ihn ganz direkt, wie lange mein Krebs mir noch Zeit ließe. Er möge aber nicht sagen, dass es darauf ankäme.
„Jo, also Klartext: maximal ein Jahr, wahrscheinlich aber kürzer. Wahrscheinlicher sind sieben oder acht Monate.“
„Danke für die klaren Worte. Machs gut und schicke bald die Rechnung. In zwei Wochen werde ich nicht mehr erreichbar sein.“
„Was hast Du vor, lieber Joseph?“
„Mach Dir keine Sorgen. Zunächst werde ich so vor mich hinkrebsen und meinen absterbenden Körper beobachten. Das will ich aber im Süden in der warmen Sonne tun und nicht hier in dieser fast immer trüben Stadt. Außerdem möchte ich für Helene kein Pflegefall werden und rechtzeitig Hand an mich legen können. Ich will meine letzten Tage einfach nur genießen und mein Geld ausgeben. Muss für niemand mehr sorgen und habe auch keine Erben. Nur ein Problem habe ich noch. Wann merke ich, dass die Zeit gekommen ist, dass ich Hand an mich legen muss?“
„Das merkst Du mit Sicherheit, glaube mir!“
„Bevor ich verschwinde, sag mir bitte noch, warum es mit dem linken Bein immer schlechter wird?“
Manfred erklärte mir, dass im Verlauf vieler Krebserkrankungen Schmerzen an verschiedenen Stellen auftreten könnten. Das liege daran, dass der Tumor das ihn umgebende Gewebe verdränge, in Nachbarorgane hineinwachse oder auf Nerven drücke. Es könnte sogar sein, dass fortgeleitete Schmerzen auftreten. Diese würden dann nicht am Ort ihrer Entstehung wahrgenommen, sondern in einer anderen Region des Körpers.
„Deine malignen Melanome haben schon eine sehr höckerige Oberfläche und Knötchen, was deutlich auf eine vertikale Wachstumsrichtung hinweist. Sie haben auch schon Metastasen gebildet und diese befinden sich in der Leistengegend. Es ist aber unwahrscheinlich, dass Dein Verstand leiden wird.“
„Na, dann bin ich ja beruhigt“, antwortete ich und verließ meinen Schulfreund. Die Sekretärin konnte ich nicht mehr grüßen, mein Hals war zu trocken geworden. Ich dachte nur noch daran, dass ich noch acht Monate hätte.
Helene würde ich nichts von der Diagnose sagen, das stand fest.
Doris ginge mir nur auf die Nerven, wenn sie wüsste, dass es bald mit mir vorbei sein würde.
„Wenn ich jetzt einfach die Beziehung zu Doris beende, hätte ich meine Ruhe und sie müsste mich nicht bemuttern, was mich ohnehin entsetzlich stört. Wegen meines fast schwarzen Beines läuft im Bett ohnehin nichts mehr. Ist doch eine reine Vernunftsbeziehung geworden. Außerdem habe ich sie doch nur benutzt, um gegenüber Helene einen Scheidungsgrund zu haben“, überlegte ich einen Moment lang.
„Nein, das ist unfair nach der Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Außerdem hat sie sich so auf die Kreuzfahrt gefreut“, sagte ich mir.
In meinem Büro wartete Doris. „Wann wirst Du Dir endlich ein Handy zulegen. Ich versuche schon den ganzen Tag Dich zu erreichen und niemand weiß, wo Du bist.“
Ich gab ihr keine Antwort.
Sie wusste ganz genau, dass ich außerhalb des Büros für niemanden erreichbar sein wollte. Und im Büro lief jeder Anruf über die Geschäftsstelle und die Zimmerfrau, so nannte ich die Beamtin, die eigentlich Zimmermann hieß. Sie ließ ohnehin kaum ein Gespräch durch.
Heute hatte ich sie offenbar mit „Frau Zimmermann“ angesprochen und sie reagierte darauf sehr erstaunt.
„Seit mehr als fünf Jahren sagen Sie „Zimmerfrau“ zu mir, was ist mit Ihnen los?“, fragte sie mich und sagte dann gleich: „Wir haben nicht damit gerechnet, dass Sie heute noch einmal kommen würden. Es ist alles erledigt und auch schon an Ihre Vertreterin delegiert und zu deren Unterschrift umgeschrieben.“
„Was hätte ich all die Jahre nur ohne diese Frau gemacht?“, dachte ich mir und ging wortlos in mein Büro.
Doris fuhr das Auto nach Hause. Sie redete wie ein Wasserfall, wobei es immer nur um die Kreuzfahrt ging, zu der ich mich hatte überreden lassen. Ich hörte nicht wirklich zu, sagte aber von Zeit zu Zeit: „Ja, ja.“ Gott sei Dank wollte Doris zu sich nach Hause. Ich war richtig froh darüber, dass sie nicht über Nacht blieb.
„Was hatte Manfred, der Professor, gesagt? Maximal noch ein Jahr; wahrscheinlich aber weniger“, überlegte ich erneut.
„Was, oder wie lange ist weniger? Ein Jahr hat 365 Tage. Aber wie viele Tage sind weniger? Wenn ich die Melanome an meinem Bein betrachte, wird es wohl eher weniger sein.
Читать дальше