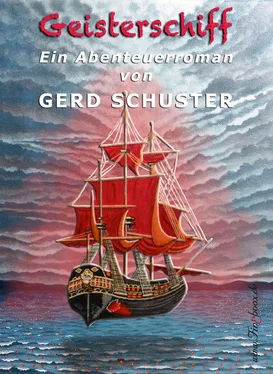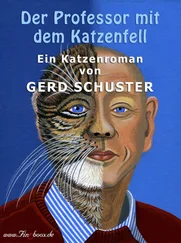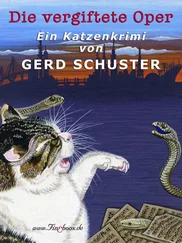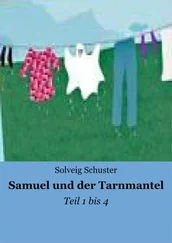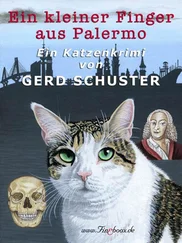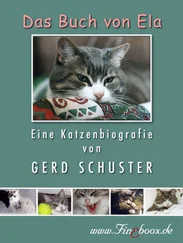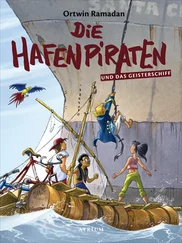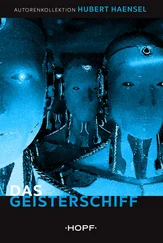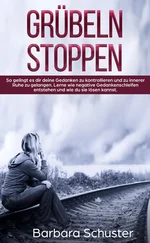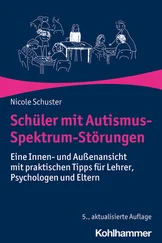Ich war heilfroh, dass ich keine weiteren Angehörigen ertrunkener Crewmitglieder aufsuchen und befragen musste. Ich wühlte nun einmal nicht gerne in den Wunden anderer Menschen; und ich hatte mich immer noch nicht vollkommen von dem Gespräch mit Mrs. Shearer erholt. Solange ich nicht wusste, ob es Wahrheit oder Wahn gewesen war, würde es mich verfolgen.
Ein weiterer kleiner Lichtblick war die Expertise der süddeutschen Universität, die im Besitz der »mitteleuropäischen Eichenchronologie« war und Laxmis Nixenschwanzscheibe analysiert hatte. Demnach stammte das Holz, aus dem die Galionsfigur geschnitzt worden war, von einer Eiche aus dem Spriegelbachtal bei der Stadt Titisee im Schwarzwald. Der Baum war im Jahre 1613 gefällt worden.
Dankenswerterweise war der Analyse ein Kommentar des Leiters der Forschungsgruppe beigefügt, in dem dieser erklärte, wie ein niederländischer Nixenschnitzer um 1600 an eine Eiche aus Süddeutschland kommen konnte.
Ich staunte. Da hatte jemand seine kleinen grauen Hirnzellen benutzt. Laxmi hatte den Testern nichts vom maritimen Ursprung der Holzprobe mitgeteilt. Aber Professor Arno Möller, der Autor der Anmerkungen, hatte aus dem Salzgehalt der Probe und Farbresten an ihrem Rand korrekterweise auf eine nautische Vergangenheit geschlossen.
Im ausgehenden Mittelalter und der frühen Neuzeit, schrieb der Forstforscher in seinem zweiseitigen Begleitbrief, hätten viele Teile Europas unter schwerem Holzmangel gelitten – der Folge jahrhundertelangen Raubbaus in den Wäldern. Besonders in den seefahrenden Nationen sei Holz zur Rarität geworden, weil man wegen der vielen verlustreichen Seeschlachten ständig gezwungen war, neue – hölzerne – Kriegsschiffe zu bauen.
Der Not gehorchend, hätten viele Seemächte ihr Baumaterial von weither bezogen, meist aus den dünn besiedelten, aber dicht bewaldeten europäischen Mittelgebirgen. So seien auch die Pfähle, auf denen man die Lagunenstadt Venedig – viele Jahrhunderte lang eine wichtige Seemacht – errichtet habe, aus Dalmatien und den Alpen herbeigeschafft worden.
Das kleine und bis auf seine Pappelalleen relativ kahle Holland sei ebenfalls von allen nutzbaren Bäumen entblößt gewesen. Also hätten die Niederländer im ganzen Schwarzwald und schließlich auch im Ostseeraum Holz gekauft.
Nachschub war dringend nötig, denn man habe in den Werften wie besessen gearbeitet: Mitte des 17. Jahrhunderts seien mehr Schiffe unter niederländischen Segeln über die Weltmeere gekreuzt, als alle übrigen europäischen Staaten zusammen besaßen, und die Holländer hätten lange als die besten Schiffsbauer der Welt gegolten.
Holz sei aber nicht nur als Universalbaustoff gefragt gewesen, aus dem neben Kriegsschiffen und Handelskoggen auch Burgen, Häuser und Brücken errichtet, Fuhrwerke gebaut und Werkzeuge, ja selbst Trinkbecher, Löffel und Gabeln gefertigt worden seien; auch als Brennstoff sei es heiß begehrt gewesen. Salzsiedereien, Kalkbrennereien, Glashütten, Töpfereien und natürlich Köhler seien ohne Holz nicht ausgekommen. Der Nachschub für Öfen und Werften sei meist per Floß auf dem Rhein herangeschippert worden.
Die Holzknappheit sei so schlimm geworden, dass sie den Bauernkrieg von 1525 ausgelöst und im Dreißigjährigen Krieg die Schweden zum Einmarsch ins holzreiche Pommern bewogen habe.
Der holländische Holzhunger habe sogar Spuren in der Sprache der Lieferländer hinterlassen, hieß es am Ende von Möllers Schreibens. Im Schwarzwald, aus dem die Niederlande kerzengerade Tannen für Masten und krumme Eichen für die gebogenen Spanten bezogen, kenne man heute noch den Begriff »Holländertanne« für besonders geradewüchsige Bäume der Gattung Abies. Abies, nahm ich an, war der »Familienname« der Tanne.
Ich war wirklich beeindruckt: Zwar hatten sich die Deutschen im Krieg auch auf Alderney gehörig danebenbenommen – unter anderem hatten sie während der fünfjährigen Besetzung der Insel ein KZ errichtet, das sie »Lager Sylt« genannt hatten – aber ihre Wissenschaftler waren Spitze. Ohne Möllers Anmerkungen hätte ich wahrscheinlich wieder mit dem Schicksal gehadert, weil ich, statt Lösungen zu finden, immerzu auf neue Rätsel stieß.
Ich rief den Professor an, bedankte mich herzlich für seine Erklärungen und beglückwünschte ihn zu seiner Spürnase. Der Gelehrte war hocherfreut, als ich ihm mitteilte, sein Testobjekt entstamme einer alten Galionsfigur. So etwas habe er vermutet, sagte er. Das Holz alter Segler sei seine Leidenschaft, und wenn ich keine Einwände hätte, so würde er die aufgenommene Spur gern weiter verfolgen – ganz privat und kostenfrei natürlich, aus professioneller Neugier sozusagen. Es gebe ein globales Netzwerk von Dendrologen, dessen geballtes Wissen schon die erstaunlichsten Problemlösungen ermöglicht habe. Oft besitze einer der Kollegen ein Stück Planke eines gescheiterten alten Handelseglers, ein anderer eine Hälfte des Bugspriets, und der dritte den Schreibtisch des Skippers mitsamt dem Logbuch.
Selbstverständlich könne er nach Herzenslust weiter forschen, sagte ich, und versprach, ihm meine Kontaktdaten zu mailen.
Den Reading Room des British Museum suchte ich dieses Mal ohne Aufforderung Laxmis auf. Zwar hatte meine Galionsfiguren–Recherche wenig Nutzbares erbracht; aber einmal wusste ich über den Fliegenden Holländer kaum mehr, als ich vor meinem Besuch in dem Kuppelsaal über die Schnitzwerke am Bugspriet gewusst hatte, und zweitens fiel mir nicht ein, was ich – außer Lesen – im Fall der »Palermo Express« unternehmen konnte. Es gab keine einzige Spur!
Es kostete mich ein wenig Überwindung, am Service Desk nach Literatur zum Thema »Fliegender Holländer« zu bitten. Die Reaktion war jedoch keineswegs spöttisch oder mitleidig, wie ich befürchtet hatte. Stattdessen brachte die Erwähnung des Geisterschiffes schlagartig Leben in das gelangweilte Gesicht der blassen und demonstrativ ungeschminkten jungen Frau am Tresen.
»Der Fliegende Holländer?«, sagte sie eifrig. »Da ist unser Dr. Lustig der Experte. Er befasst sich schon seit fünfzig Jahren mit diesem Thema und kennt jede Quelle. Er ist schon lange im Ruhestand, für uns aufgrund seines reichen Spezialwissens aber als ehrenamtlicher Mitarbeiter unentbehrlich. Ich denke, er wird sich über Ihr Interesse freuen. Einen Augenblick bitte, ich hole ihn.«
Sie kam mit einem sehr kleinen Mann im Schlepptau zurück, der mindestens siebzig Jahre alt sein musste. Ich vermutete, dass er älter war, denn er wirkte teilmumifiziert. Unter der weißen Mähne, die wie der Strandhafer von Alderney auf seiner Schädeldecke wucherte, spannte sich die Gesichtshaut ohne nennenswerte Gewebeunterfütterung über Stirn, Wangenknochen und Kinn. Die Nase sah gefriergetrocknet aus und erinnerte an die einer tausendjährigen Gletscherleiche. Ihre Nüstern waren dünn und transparent wie Pergament und erschienen extrem brüchig. Ein kräftiges Schnäuzen würden sie niemals überstehen, dachte ich.
Richtig lebendig wirkten nur Lustigs rosige, fleischige Ohren und die viel zu prallen und zu roten Lippen seines ein paar Nummern zu groß geratenen Mundes. Lauscher und Lippen sahen wie transplantiert aus und schienen von einem separaten jugendlichen Blutkreislauf versorgt zu werden. Die großen rehbraunen Augen des Bibliothekars lagen tief in ihren Höhlen, brannten aber wie Scheinwerfer und sprühten wie Wunderkerzen. Die buschigen Augenbrauen, die sich in regem Wechsel hoben und senkten, waren knallbraun und ganz sicher gefärbt.
Dr. Lustig wuselte an seiner Kollegin vorbei zum Tresen, lächelte mich freundlich an, wippte leutselig mit den Augenbrauen und sagte mit einem Hexenstimmchen: »Soso, der Fliegende Holländer hat Ihr Interesse gefunden! Sieh mal einer an! Es gibt noch Zeichen und Wunder! Welchem Zweck dient Ihre Recherche, wenn ich fragen darf?« Er hatte einen leichten, aber ziemlich kratzigen deutschen Akzent, der sich vor allem bei seinen Rs und Vs bemerkbar machte. »Ich möchte einen Dokumentarfilm über das Phänomen machen!«, antwortete ich.
Читать дальше