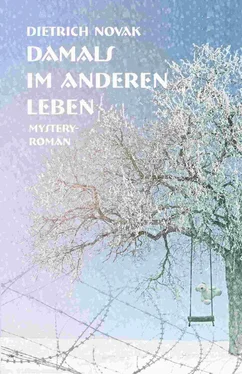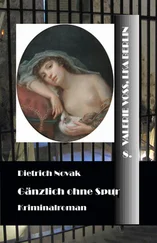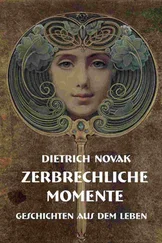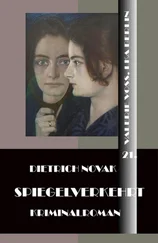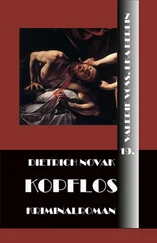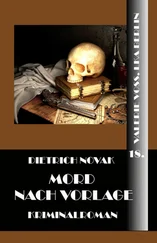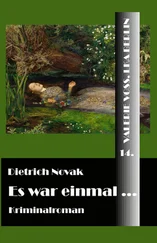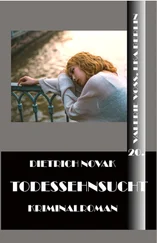Kaum waren die Wörter heraus, hätte er sich die Zunge abbeißen können. Melanies tiefe Verzweiflung brachte langsam seine gewohnte Selbstsicherheit ins Wanken.
Danke, dass du mich daran erinnerst, dachte Melanie, sagte aber nur: »Ich gehe jetzt unter die Dusche und koche mir noch brav eine Tasse Tee. Du kannst mich in einer Stunde abholen. Bis dann!«
Sie legte ohne eine Antwort abzuwarten auf. Im selben Moment tat es ihr leid. Trutz war nicht für ihren Schmerz verantwortlich und gab sich alle Mühe ihr beizustehen. Sie nahm sich vor, in der nächsten Zeit Gesellschaft zu meiden, um nicht unabsichtlich andere zu verletzen.
Auf dem Weg in die Küche entschied sie sich für Kaffee statt Tee. Beim Bedienen der Kaffeemaschine glaubte sie für einen Moment, ihre Beine würden ihr den Dienst versagen. Sie zwang sich, ins Bad zu gehen und zu duschen. Als sie ihr übergroßes T-Shirt auszog, bemerkte sie, dass der feuchte Stoff die Ursache für ihr Frösteln war. Der warme Strahl der Dusche tat ihr gut. Sie wusch ihr verschwitztes, halblanges Haar und befreite ihren Körper von ihrem fiebrigen Schweiß.
Beim Abtrocknen verhinderte der Wasserdampf einen Blick in den beschlagenen Spiegel. Umso entsetzter war sie, als sie beim Haarfönen ihr Gesicht entdeckte. Ihre dunkle Mähne umrahmte ein leichenblasses Gesicht mit stellenweise hektischen Rötungen. Ihre dunkelbraunen Augen lagen tief in den Höhlen und wirkten glanzlos. Dunkle Augenringe gaben ihr ein krankes und übernächtigtes Aussehen.
Melanie band ihre Haare zusammen und formte einen Nackenknoten. Obwohl sie die gleichen Pflegepräparate wie immer benutzt hatte, wirkten die Haare glanzlos wie ihre Augen. In einer Frauenzeitschrift hatte sie gelesen, dass man an den Augen und Haaren den seelischen Zustand eines Menschen erkennen könne. Den Beweis bot ihr der Spiegel.
Sie legte eine leicht getönte Tagescreme auf und wählte einen Lippenstift mit unauffälligem, bräunlichem Farbton. Die Augenringe milderte sie mit Abdeckstift und beendete das Make Up mit einem transparenten Puder. Es kam ihr weniger darauf an, gut auszusehen, als nicht von jedem darauf angesprochen zu werden, wie elend sie aussähe. Als sie Unterwäsche und schwarze Strumpfhosen anzog, kam es ihr so vor, als ob ihre stets leicht gebräunte Haut jegliche Farbe verloren hätte. Das elegante Kostüm in ihrer Lieblingsfarbe Schwarz erfüllte seine angemessene Pflicht und unterstrich ihre zerbrechlich, leicht gespenstisch, wirkende Gestalt.
In diesem Augenblick war sie heilfroh, dass sie nicht in einem Land lebte, in dem Weiß als Trauerfarbe getragen wurde. Sie hasste diese Farbe aus vollem Herzen. Wo immer sich in der Wohnung eine andere Farbe ermöglichen ließ, hatte sie darauf zurückgegriffen. Sie besaß keine einzige weiße Tischdecke und keine weiße Bettwäsche und Laken. Sie war sich völlig sicher, dass sie darunter Erstickungsanfälle bekommen hätte.
Melanie erwischte sich dabei, sich für diese unpassenden Gedanken zu rügen. Sie sollte sich lieber überlegen, wie sie die unvermeidlichen Kondolenzbezeugungen über sich ergehen lassen könnte. Sie verabscheute dick aufgetragene Gefühle, noch dazu, wenn man sich über deren Echtheit nicht sicher sein konnte. Sie hatte so gut wie keine Einladungen verschickt. An wen auch? Sie war wie ihre Großmutter und Mutter ein Einzelkind. Großvater hatte sie nie kennengelernt und ihre Eltern waren gestorben, als sie zwei Jahre alt gewesen war. Die Verwandtschaft ihres Vaters lebte im süddeutschen Raum und hatte nie von sich hören lassen. Außer den Eltern von Trutz, einigen Nachbarn und fremden Friedhofsgängern war also niemand zu erwarten. Gut so. Selbst Trutz würde nie nachempfinden können, welchen Verlust sie erlitten hatte. Wie sollte sie nur weiterleben können?
Das Schrillen der Türklingel riss sie aus ihren Gedanken. Sie trank hastig den letzten Schluck Kaffee, schlüpfte in ihre Stiefeletten und zog ihren weichen, weiten Wollmantel an. Der schwarze, warme Stoff umhüllte sie wie ein schützendes Zelt, und sie fühlte sich augenblicklich etwas geborgener. Sie nahm ihre Umhängetasche über die Schulter und war froh, sich an etwas festhalten zu können. Nachdem sie die Wohnungstür abgeschlossen hatte, fuhr sie mit dem Lift hinunter und sah durch die Glasscheibe der Haustür die kräftige Gestalt von Trutz. Auf einmal war sie froh, nicht alleine gehen zu müssen.
Trutz nahm Melanie wortlos in den Arm und küsste sie zärtlich auf die Wange. Er versuchte so behutsam wie möglich zu sein, was ihm enorm schwer fiel, da er mit seiner etwas poltrigen Art stets ungestümer wirkte als beabsichtigt. Als Melanie neben ihm im Wagen Platz genommen hatte, stellte er erleichtert fest, dass sie wesentlich besser aussah als er befürchtet hatte. Ihm entging zwar nicht das dezente Make Up, er konnte aber nicht beurteilen, wie viel es abdeckte.
Nach wenigen Minuten erreichten sie den Blumenladen, in dem er nach Melanies Anweisungen den Grabschmuck bestellt hatte. Er parkte in zweiter Spur und schaltete die Warnblinkanlage ein. Melanie schaute gedankenverloren auf einen imaginären Punkt in der Ferne und nahm keine Notiz von dem Geschäft.
Als Trutz zurückkam, saß sie unverändert auf ihrem Platz, mit dem gleichen abwesenden Ausdruck. Er verstaute seinen mittelgroßen Kranz, der mit lachsfarbenen Rosen geschmückt war, und Melanies Gesteck aus Lilien und roten Rosen im Kofferraum. Er hatte sich an ihren Wunsch gehalten und auf jegliche Schleifen verzichtet.
Melanie war der Meinung, dass die schwülstigen Texte auf derlei Schleifen völlig überflüssig waren. Ihre Großmutter konnte sie nicht mehr lesen, und den Spruch für die Augen fremder Leute zu dekorieren, fand Melanie geradezu absurd. Es ging niemand etwas an, wie sehr sie diese wunderbare Frau verehrt hatte. Das Gleiche galt auch für Grabsteine. Für Melanie hatten diese ihre Berechtigung allenfalls, wenn sie als kleines, privates Denkmal dienten. Dazu reichten der Name und die Geburts- und Sterbedaten. Bedeutungsschwangere Worte wie: „Unvergessen“ oder Aussagen wie: „Hier ruht in Frieden …“, fand Melanie geradezu peinlich. Dass ein geliebter Mensch unvergessen bleibt, war eine Selbstverständlichkeit, und ein einziger Satz in Goldbuchstaben konnte niemals der Komplexität eines Menschen gerecht werden.
Des Weiteren trug sie eine unbestimmte Ahnung in sich, dass die friedliche Ruhe mehr einem Wunschdenken entsprach, nur vorübergehend sein würde und sich überhaupt nur auf den Körper beziehen konnte. Der Hülle für ihre Dienste zu danken, sollte Aufgabe der Verstorbenen sein, und dem spirituellen Wesen, das sich dieser Hülle bedient hatte, konnte man sicher überall woanders als ausgerechnet auf dem Friedhof begegnen.
Vera war froh, dass ihre Mutter Doris noch nicht von der Arbeit zurück war, als sie von ihrem Krankenbesuch bei Marie nach Hause kam. So konnte sie noch eine Weile ihren Gedanken nachhängen. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter war nicht das beste. Man respektierte sich gegenseitig, doch man pflegte keinen liebevollen Umgang miteinander. Das war nicht immer so gewesen. Vera erinnerte sich an unbeschwerte Kindertage, die von Lachen und heiterer Gelassenheit geprägt waren. Das änderte sich schlagartig, als ihr Vater sich einer anderen Frau zuwandte und die kleine Familie verließ. Fortan neigte Doris zu Depressionen und unbotmäßiger Härte gegenüber Vera. Sie zeigte zwei Gesichter. Nachts hörte Vera sie oft weinen, aber am Tage trug sie eine strenge, undurchschaubare Maske. Wahrscheinlich war Doris der Meinung, Vera den Vater nur dadurch ersetzen zu können, indem sie kaum zärtliche Regungen zeigte, sondern streng und autoritär zu Werke ging. Später beneidete Vera Marie oft um ihre Eltern, die viel lockerer und liebevoller waren.
Ironie des Schicksals war, dass die beiden Freundinnen sich total gegensätzlich entwickelt hatten. Vera, die als Erwachsene zu Unbeherrschtheit und schonungsloser, manchmal verletzender Ehrlichkeit neigte, war das sanfte, stille Kind gewesen. Während die eher introvertierte, sanftmütige Marie ein Problemkind gewesen war, das zu Wutanfällen neigte und grundsätzlich alles verneinte. Die Wörter Mama und Papa hatte sie nie ausgesprochen. Stattdessen behauptete sie standhaft, Cornell und Rolf seien nicht ihre Eltern und dass sie „nach Hause“ wolle. Cornell, eine ehemals quirlige Person, die alles andere als ein auffälliges Kind gewollt hatte, war alsbald überfordert gewesen, zumal der Kunstmaler Rolf, der als Buchillustrator für einen Verlag arbeitete, alles gelassener hinnahm und seine künstlerische Ader ihn toleranter erscheinen ließ. Kleine Kinder lebten nun mal in einer Fantasiewelt, beruhigte er seine Frau und auch sich selbst.
Читать дальше