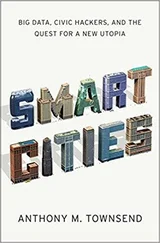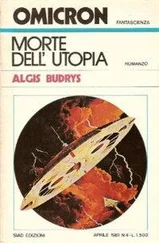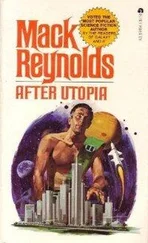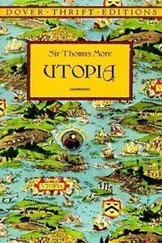Peer zog sich an und trat vor die Haustür. Die Luft des zweiten Aprils war genauso ausdruckslos wie die des ersten Aprils. In seinem Viertel der Stadt war alles unverändert. Es war einfach nur so, dass ein Bewohner plötzlich reich war, während der Rest auf den Status Quo sitzen blieb. Wobei der Status Quo für die meisten Leute hier gar nicht so übel war. Schließlich litt die Stadt nicht unter Arbeitslosigkeit und hohen Mieten. Es gab einfach nur attraktivere Städte.
Nur Peer Flint, wohnhaft im Molkereipfad 64, war nun ein reicher Mann. Aber das sah man ihm beim besten Willen nicht an. Vielmehr wirkte er in seiner alten Jeans und mit seinem beigen Mantel wie jemand, der die Bushaltestelle nach einer durchzechten Nacht nicht fand. Seine Bartstoppeln verstärkten den Eindruck nur noch.
Für einen kurzen Moment überlegte er wieder einmal, dem Bistro im Haus einen Besuch abzustatten. Allerdings sah er aus dem Augenwinkel den mies gelaunten Küchenchef, der wie eh und je darüber nachdachte, mit welcher Ausrede er seine Frau dieses Mal zusammenstauchen würde. Der Mann war nicht besonders groß, aber kräftig gebaut. Mit dem richtigen Werkzeug ausgestattet hätte er durchaus zum Mörder getaugt.
Wenig später stillte Peer seinen Hunger schließlich an einem unscheinbaren Würstchenstand in der Innenstadt. Er aß hier recht häufig, wenn er seine Mittagspause hatte. Der Verkäufer sprach ihn darauf an. Schließlich hatte er nicht mehr mit Peer gerechnet, denn Peers übliche Mittagszeit war lange rum.
„Habe frei“, sagte Peer schmatzend. Ein Stück Wurstpelle hatte sich zwischen seinen Schneidezähnen an einer Position verfangen, an der man es unmöglich durch Zungenbewegungen herauspulen konnte und Peer dachte kurz über einen Zusammenhang zwischen dem Speiserest zwischen seinen Zähnen und seiner Unehrlichkeit diesem fremden, loyalen Wurstverkäufer gegenüber nach, kam aber zu keinem sinnvollen Schluss.
„Gut für Sie“, sagte der Mann gleichgültig und fertigte zwei Bockwürste mit Senf für ein paar Kinder ab. „Will auch gern frei haben. Habe immer gesagt: Irgendwann verdiene ich hiermit Kohle. Und dann verkauf ich den Stand. Und dann geht es nach Spanien. Da ist doch alles billiger!“
„Ist das so?“ Der Fleischfetzen rutschte ein wenig nach oben.
„Ja, ja. Wenn ich es doch sage. Nach der Finanzkrise vor allem. Häuser sind jetzt billig in Spanien. Aber was erzähle ich Ihnen das. Sie sind ja auch gefangen in Ihrem Büro! Wir arbeiten – und die da oben haben vom lieben Gott doch alles Geld in den Arsch geblasen bekommen!“
„Oder von ihrer Genetik“, nuschelte Peer beim Versuch, sich die Zähne mit seinem Daumennagel zu reinigen.
„Wie jetzt?“, kam es von dem Wurstverkäufer. In seinem fettigen Gesicht machte sich tiefes Unverständnis breit. Probehalber krempelte er sich die Ärmel über die fettigen Arme, aber das half seinem Verständnis auch nicht auf die Sprünge.
Peer guckte ihn einen Moment an. Dann entschied er, auch dem Inhaber seiner Würstchenbude nichts zu erzählen. Dafür liquidiert zu werden, diesem Statisten in seinem Leben etwas Wichtiges zu erzählen, war nun wirklich absurd! „War nur so ein Gedanke“, sagte Peer deshalb.
„Was?“
„Ach, nichts. Ist egal.“
„Genetik?“, wunderte sich der Wurstbudenmann und öffnete seine Augen so weit es ihm möglich war. Das rechte Auge wurde dabei weiter als das Linke. „Mit Kindern? Mit Kindern macht man Geld? Die kosten doch nur Geld!“ Er lachte laut und dreckig. „Sie sind ja einer: glauben Sie wirklich , dass Kinder unser Kapital wären? Die fressen doch Geld. Wollen dieses und jenes! Zum Glück habe ich keine!“
Das war auch Peers Gedanke und er verabschiedete sich. Bis dahin war ihm der Würstchenmann immer sympathisch gewesen. Aber wahrscheinlich lag das daran, dass es gerade eben die erste Unterhaltung der beiden gewesen war.
Im nächstbesten Laden kaufte sich Peer ein paar bessere Klamotten, unter anderem ein Sakko für seinen Aufenthalt bei GAS. Er hatte zwar keine Vorstellung von der Etikette dort, und Melv und Ruben waren schließlich nur ordentlich gekleidet gewesen, aber ein Unternehmen, das mal eben zwölf Millionen Euro für seinen Körper aufwenden wollte, konnte so schäbig nicht sein. Und die Verkäuferin war auch sehr freundlich zu ihm; sie reichte ihm einen Zahnstocher, den er dankend annahm. Er versah sie deshalb mit einem Fünfer an Trinkgeld. Erst war sie ein wenig brüskiert, aber als er dann nicht nach ihrer Nummer fragte, akzeptierte sie den kleinen Obolus.
Er kaufte in ein paar anderen Geschäften allerlei Kleinkram auf, den er sonst auch kaufte: Socken, Rasierklingen und Deodorant zum Beispiel. Nach einiger Suche trieb er zudem einen Katalog für Wintergärten und andere Glasbauten auf. Anschließend hob er zweitausend Euro von seinem Konto ab und überlegte, was er mit dem Geld anfangen wollte. Darum faltete er einen Flieger aus einem Zwanziger, wartete auf einen Windstoß und ließ das Ding fliegen, segeln, abstürzen und circa vier Meter weiter, mitten auf der Straße, landete der arme Geldschein auf dem Asphalt. Ein Auto näherte sich, überrollte den Flieger und ließ ihn, platter als vorher, wie ein Bonbonpapier noch einmal segeln. Dann landete das schmutzige Ding noch einmal auf der Straße. Peer betrachtete das Schauspiel und zuckte mit den Schultern.
Und so vertrödelte Peer dann Stunde um Stunde in der Innenstadt, war schlecht rasiert und hatte einiges an Bargeld in den Taschen. Er versuchte auch mehrmals vergeblich, sich eine teure – aber bloß nicht zu teure - Armbanduhr auszusuchen. Es scheiterte maßgeblich daran, dass er sich fragte, warum irgendwer (und irgendwer besaß in seiner Vorstellung immer ein Mobiltelefon) eine solche benötigte. Ein Blick auf eben jenes Telefon genügte schließlich. Leere Akkus überzeugten ihn gedanklich auch nicht so recht. Schließlich waren Uhren doch immer und überall vorhanden.
Dann fiel ihm eine Uhr ein, die am Bahnhofsvorplatz stand. Sie stand immer auf Punkt zwölf. Und das seit Jahren. Vielleicht gab es auch Orte, an denen alle Uhren still standen und auf diese Orte wollte er dann doch vorbereitet sein.
Ein leerer Handyakku und ein paar tote Uhren in Gedanken zwangen ihn schließlich dazu, sich doch für eine Armbanduhr zu entscheiden. Es wurde dann ein schmuckes Modell: Oris Classic Date .
„Schweizer Produkt, ideal für den dezenten Herrn“, erklärte der junge Verkäufer. Sein Gesichtsausdruck machte offensichtlich, dass er sich eine Provision versprach. „Goldbeschichtung auf Edelstahl, mit Datumsanzeige. Schauen Sie mal!“
Peer wurde die Uhr in die Hand gedrückt. Er verstand davon nichts, aber nickte wissend. Er befand sie für funktional und wenig aufdringlich.
„Kalbslederband. Weich, gut für die Haut. Arbeiten Sie körperlich?“, wollte der Verkäufer wissen.
„Nein. Aber ich kann sie auch beim Sport tragen?“, fragte Peer. Nicht, dass er je wirklich Sport trieb, aber durch eine Gegenfrage wurde seine Antwort länger und damit war er nicht ganz so verloren im Gespräch.
„Natürlich! Diese Uhr ist ein sicherer Begleiter für alle Lebenslagen“, bejahte der Verkäufer und zwinkerte Peer zu. Wer diesem Kunden in seinem alten Mantel und mit ungepflegten Gesicht zuzwinkerte, verkaufte auch Seniorinnen Lebensversicherungen.
„Gibt es die auch mit schwarzem Ziffernblatt?“, wollte der Umgarnte noch wissen. Der junge Mann reichte ihm ein anderes Exemplar. Dieses gefiel Peer dann gut genug, um es mitzunehmen. Er zahlte bar und ließ sich die Uhr um sein Handgelenk legen. Peer fühlte sich gleich ein Stück wertvoller.
Mit der vom Ärmel verborgenen Uhr und seinen Einkäufen kam er dann zurück in seine Wohnung. In selbiger fand er eigentlich alles, was er wollte. Bad, Küche und Schlafzimmer waren vorhanden und waren genauso so selbstverständlich und gemütlich wie immer.
Читать дальше