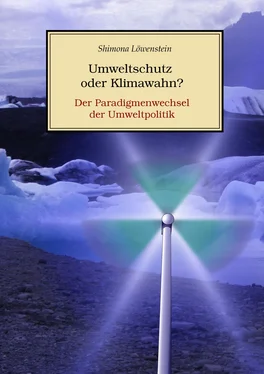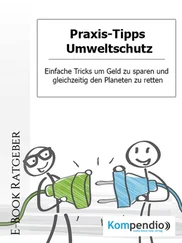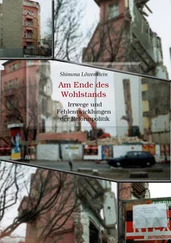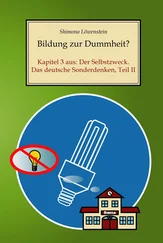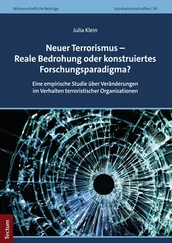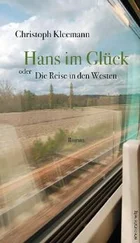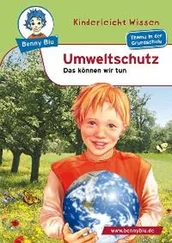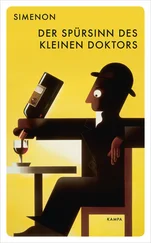1 höhere Preise für Nahrungsmittel bezahlen,
2 höhere Steuern in Kauf nehmen, die zum Aufkauf der Überschüsse, deren Transport, Lagerung (einschließlich Energiekosten) und gegebenenfalls Vernichtung notwendig sind,
3 die Kosten tragen, die z.B. durch den Nitrateintrag ins Grundwasser entstehen, ohne im privaten Kalkül des Landwirts zu erscheinen,
4 die Schadstoffbelastung seiner Nahrung und die damit verbundenen Krankheiten hinnehmen und auch deren Kosten tragen.
Deshalb wird die Agrarpolitik auch als eine unzulässige Begünstigung von Partialinteressen auf Kosten der Allgemeinheit kritisiert. Demnach besitzt die Landwirtschaft Effizienzvorteile hauptsächlich bei der „Produktion politischen Einflusses“. Durch die Integration der EG wurde die Vorzugsbehandlung der Landwirtschaft verstärkt und die Abschirmung vor oppositioneller Wählerkontrolle stabilisiert. [41] Mit dem ursprünglichen „sozialen“ Anliegen, nämlich der Angleichung der stagnierenden Einkommen der Bauern an die der übrigen Bevölkerung, die ohnehin nicht erreicht wurde, haben die Agrarsubventionen jedenfalls nicht mehr viel zu tun. Da sie proportional zur Produktion gewährt werden, profitierten von ihnen am meisten nicht die kleinen „Bauern“, die es zumindest in Westeuropa kaum mehr gibt, sondern die größten und reichsten Landwirte bzw. die industrialisierten agrarischen Großbetriebe. Gegen den Verzicht auf Manipulation der landwirtschaftlichen Produktion durch Preisfixierung und Subvention wurde oft behauptet, dieser hätte zu einer noch größeren Konzentration der agrarischen Produktion und weiteren Verdrängung bäuerlicher Betriebe durch agrarindustrielle Großunternehmen und zur Produktion von billigstmöglichen Nahrungsmitteln mittels weiterführenden Raubbaus geführt. Diese Behauptung läßt sich nicht nachprüfen: Es ist zwar möglich, daß es unter den Bedingungen des freien Marktes zu einer ähnlichen Entwicklung gekommen wäre. Auf jeden Fall wirkt aber die Subventionspolitik nicht dem Trend entgegen, sondern unterstützt ihn.
Man behauptet heute, die riesigen Überschüsse („Butterberge“ usw.) gehören der Vergangenheit. Das bedeutet freilich nicht, daß die Agrarpolitik keine Probleme mehr verursacht. Manchmal sind es gerade die Lösungen, die mit der Beseitigung eines unerwünschten Effekts andere, möglicherweise noch größere, bewirken. Durch die Quotenregelung für Mengen und Qualität der Produkte, die hauptsächlich von den ex-sozialistischen EU-Mitgliedern als ungerechtfertigter Eingriff in ihre Wirtschaft und Lebensweise empfunden wurde, kam ein planwirtschaftlicher Ansatz zurück, der alle Abweichungen von den festgesetzten Normen verhindert, dem proklamierten Wettbewerbsprinzip zuwiderläuft und bekanntermaßen nicht funktionieren kann, zumindest nicht ohne einen ungeheuren Aufwand an externen Kosten, die mit den bewilligten Milliarden noch lange nicht erschöpft sind. Darüber hinaus wird auch schon lange kritisiert, daß die Europäische Union durch Einfuhrbeschränkungen und -zölle sowie Exportzuschüsse , genannt auch Exportbeihilfen, die wohl die anfallenden Überschüsse reduzieren sollten, die eigene Landwirtschaft beschützt und die bäuerliche Produktion der armen Länder Afrikas ruiniert, indem sie diese mit EU-Lebensmitteln zu Dumpingpreisen überschwemmt. Einige Millionen Menschen jährlich dürften deswegen ihre Lebensgrundlage verlieren. [42] Hier hat sich die angeblich als „soziale Maßnahme“ gedachte Ladwirtschaftspolitik offensichtlich in das genaue Gegenteil davon verwandelt.
Wie man sieht, hat diese irrationale und an bloße Lobbyinteressen orientierte Verschwendung von Lebensmitteln, die mit einer allmählichen Zerstörung unserer Lebensgrundlagen, der Mannigfaltigkeit der Landschaft, der Vielfalt traditioneller Lebensweisen und der Selbstregulierungsfähigkeit der Wirtschaft einhergeht, mit Herstellung von gesunden Lebensmitteln und Landschaftspflege nicht mehr viel zu tun. Die europäische (und damit auch die deutsche) Agrarpolitik stellt vielmehr, wie ihr fast vom Beginn an immer wieder diagnostiziert wurde, ein durch Protektion, Subvention und Standardisierung erreichtes finanzielles und ökologisches Desaster dar. [43]
Um die bestehenden Schäden zumindest nicht mehr zu vergrößern, bzw. den Trend allmählich zu wenden, wurden bereits in den 80er Jahren seitens der Umweltökologie Konzepte zur Instrumentalisierung der Umweltpolitik in der Landwirtschaft entwickelt, wie zum Beispiel eine direkte Bezahlung der Bauern als Landschaftspfleger oder eine Vergabe von Bewirtschaftungsbeiträgen für umweltrelevante externe Leistungen. [44] Einen anderen Vorschlag zur nicht-staatlichen Bereitstellung des Gutes „bäuerliche Kulturlandschaft“ bot z.B. Yelto Zimmer mit Hilfe des Konzepts der Clubgüter. [45] Weitere Vorschläge waren die Schaffung zusätzlicher Naturschutzgebiete und ähnliche Maßnahmen, [46] die zumindest kostengünstiger, effektiver und wirtschaftlich ebenso wie ökologisch vertretbar wären. Es handelte sich dabei zumindest um keine direkten Eingriffe in den Markt, sondern lediglich um Nachfrage des Staates nach Landschaftspflege, Erhalt der Bodenfruchtbarkeit oder nach gesunder Ernährung der Bevölkerung (weniger belasteten Nahrungsmitteln). Überdies wäre eine Erhebung von Abgaben bei umweltbelastender Produktion zum Ausgleich für die auf die Gesellschaft umgewälzten externen Kosten möglich, die zugleich ein sinnvoller Anreiz für den Umstieg auf nichtkonventionelle Landwirtschaftsformen wäre. [47]
Zumindest die vermehrte Förderung von kleinen landwirtschaftlichen Betrieben mit einem höheren Grad an endogenen Stoffkreisläufen, wie es z.B. die „biologisch-dynamische Wirtschaftsweise“ und ähnliche Arten von nicht-konventionellem Ackerbau sind, [48] wäre nicht nur ökologisch relevanter, sondern auch kostengünstiger als die aufwendige naturzerstörende Flurbereinigung und Begünstigung von landwirtschaftlicher Überproduktion. Die sog. „Biobauern“ stellen aber bis jetzt nur einen winzigen prozentuellen Anteil an der gesamten landwirtschaftlichen Produktion dar. Ihre Produkte, die vornehmlich von gutsituierten grün-alternativen Eliten gekauft werden, sind in der Regel überteuert, oft mehrfach so teuer wie konventionelle. Dabei leuchtet es nicht immer ein, warum der bloße Verzicht auf chemische Düngemittel, Pestizide und sonstiges zu derart höheren Kosten (beispielsweise bei Äpfeln) führen sollte. Jedenfalls wurden gerade den Öko-Landwirten in Deutschland, trotz steigender Nachfrage , immer mehr Fördermittel gekürzt, wovon ausländische Produzenten profitieren. Für den Konsum von vorwiegend konventionell hergestellten Nahrungsmitteln wurden immer wieder die Verbraucher mit ihrem mangelndem Umweltbewußtsein verantwortlich gemacht. Das fehlende Angebot bei gestiegener Nachfrage (trotz hoher Kosten) weist dagegen darauf hin, daß es nicht die Verbraucher sind, die kein Interesse daran haben, an dem Status quo der konventionellen Landwirtschaft etwas zu ändern. [49]
Angesichts der Umweltbeeinträchtigungen durch die Landwirtschaft, die seit Anfang der 80er Jahre vielfach dokumentiert und kritisiert wurde, und hauptsächlich wegen der neuen, kostenintensiven Probleme (schlechte Absatzchancen auf dem Weltmarkt und folglich immer höhere Exportsubventionen, sowie immer höhere Kosten für den Aufkauf, Lagerung oder Vernichtung der Überschüsse), beschloß die EU 1992 eine „Agrarreform“ , die im Wirtschaftsjahr 1994/95 umgesetzt wurde. Die Hauptpunkte der Reform waren:
1 Abbau der Preisstützung für Getreide, Öl- und Eiweißpflanzen,
2 flächenbezogene Preisausgleichszahlungen,
3 Einführung des sog. „konjunkturellen Flächenstillegungsprogramms“.
Читать дальше