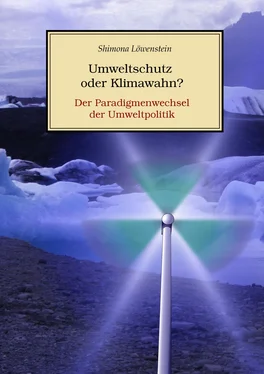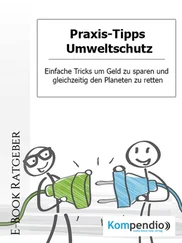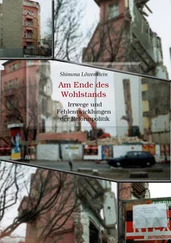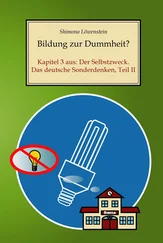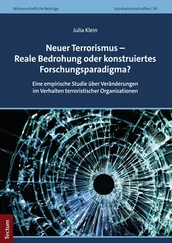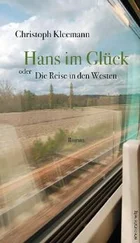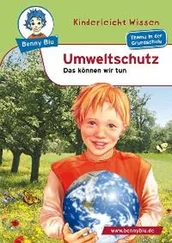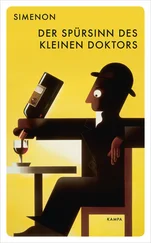Wie auch immer man dazu stehen mag, jedenfalls vergießen seltsamerweise deutsche Tierschützer eher Krokodilstränen über Wale, Robben oder Elefanten, manchmal auch Hunde und andere Tiere, die man in Asien zu essen pflegt, statt sich gegen den ungeheuren Mißbrauch unserer europäischen Nutztiere einzusetzen, [26] und protestieren lieber gegen spanische Stierkämpfe als gegen die hiesigen brutalen Schlachtungsmethoden. Das ist legitim. Allerdings sollte dabei mitberücksichtigt werden, daß ein solcher Stier immerhin im Kampf stirbt und dabei wenigstens eine, wenn auch geringe, Chance besitzt, den Toreador aufzuspießen. Im Gegensatz dazu wird der mit zum Teil nichtvegetarischen Abfällen (Fischmehl) gefütterte Schlachtochse, wenn er nicht unterwegs zum Schlachthof, eingepfercht im Waggon aus Wassermangel oder Todesangst eingeht, auf einem Laufband durch einen Bolzenschuß in den Kopf wehrlos abgeschlachtet. Wenn es sich um einen Menschen handelte, wessen Schicksal wäre da als Schlimmer zu beurteilen? Die Frage ist allerdings, ob diese Tierschützer in der Lage sind, solche Vergleiche überhaupt anzustellen.
Ein anderes Beispiel der Kontraproduktivität von bestimmten Maßnahmen, die bestimmte Tierarten vor Mißbrauch durch Menschen schützen sollte, ist das allgemeine Verbot von Elfenbeinimport in die USA und EU von 1989. Nach bestimmten Angaben entspricht die Nachfrage nach Elfenbein ungefähr dem Bestand der Stoßzähne von alten und kranken Tieren, die ohnehin getötet werden. Da dieser aber aufgrund des Handelsverbots vernichtet wird, hat dies die Zunahme von Wilderei nach jüngeren und gesunden Tieren zufolge.
Auch den Tierversuchen , deren Grausamkeit durch den scheinbaren Nutzen für die medizinische (meist aber nur kosmetische) Forschung kaum gerechtfertigt werden kann, wird im Vergleich zur üblichen Praxis der industriellen Massenzüchtung, –fütterung und –tötung unverhältnismäßig mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Wie verabscheuungswürdig sie auch erscheinen mögen, betreffen diese aber nur relativ wenige Tiere und können zumindest teilweise durch den Wunsch, Menschenleben zu retten, gerechtfertigt werden. Der Mißbrauch der Tiere in der heutigen Landwirtschaft betrifft dagegen Hunderte Millionen. Zu fragen bleibt auch, warum sich Tierschützwer nicht für das Verbot von Rattengift einsetzen, dessen Einsatz den Tieren (mit Absicht) einen langsamen und sehr schmerzlichen Tod beschert. Ginge es den Tierschützern tatsächlich um das Wohlergehen der Tiere, müßte nicht nicht da längst heftig dagegen protestiert werden?
1.2. Stadtplanung: Käfige für Menschen
In der Sicht eines rationalistischen Funktionalismus werden nicht nur Tiere auf ihre nützlichen Funktionen reduziert. Auch der „verhaustierte“ Mensch, wie es der Beobachter der Wildgänse und Begründer von Tierpsychologie Konrad Lorenz in seiner Zivilisationskritik auszudrücken pflegte, für dessen Bedürfnisbefriedigung die Tiere in bloße verwertbare Sachen umfunktioniert und mißbraucht werden, wird zum Objekt der Planung und Gestaltung der „Sozialingenieure“. Das gilt nicht nur für totalitäre Experimente, sondern auch für das architektonische Fehlprojekt der Stadtplanung. Die auf rationalistischen Vorstellungen vom Menschen und dessen Bedürfnissen begründeten Siedlungsbauprojekte mit den Postulaten von mehr Licht, Luft und Grün, die den Menschen eine vermeintlich bessere Wohnqualität bieten sollten als sog. „Mietskasernen“ (d.h. alte Häuser mit mehreren Hinterhöfen), scheiterten nicht nur im Osten. Nicht allein der heute verhaßte und inzwischen mehrheitlich abgelehnte sozialistische Plattenbau , sondern auch andere architektonische Projekte des „sozialen Wohnungsbaus“ haben sich als Fehlentwicklung erwiesen.
Die Architekten dachten an moderne Einrichtungen, Komfort und Grünanlagen und vergaßen dabei den psychologischen Faktor, das Bedürfnis nach Individualität, Kommunikation und Geborgenheit, das das eigentliche Zuhause ausmacht, dessen Merkmale jedoch zugunsten von Nützlichkeitserwägungen wegrationalisiert wurden. Mit ihren Vorstellungen von Zweckmäßigkeit berücksichtigten die Planer beispielsweise nicht die soziale Rolle der Einkaufsstraße, des Treppenhauses und Hofes als nachbarschaftlicher Begegnungsstätte; die (heute mancherorts zur Bandentreffpunkten und Drogenhandel benutzten) breiten anonymen Grünanlagen können diese Funktion nicht erfüllen. Mögen die Wohnungen auch ganz komfortabel sein, die langen schmalen Gänge, die an Krankenhäuser erinnern, und die geradezu beängstigende Atmosphäre, die den „rational“ gebauten Häusern anhaftet, wecken bei den Bewohnern das Gefühl von Isolierung, Einsamkeit, ja geradezu Bedrohung, Angstzustände und Aggressionen. Kleine „moderne“ Küchen vermitteln keine gemütliche Familienatmosphäre und niedrige Decken das Gefühl von Enge und Gefangenschaft, als befände man sich in einem Käfig. Im Gegensatz zu traditionellen „organisch“ gewachsenen Städten sind geplante städtische Siedlungen häufig unnatürliche und an den menschlichen Bedürfnissen vorbei geschaffene Lebensräume. Der genetischen Fixierung der Menschen auf Naturlandschaft und ihrem Wunsch nach eigenem Haus und Garten bzw. all den Problemen, denen man durch das Wohnen in Ballungsgebieten zwangsläufig ausgesetzt ist, werden sie nicht gerecht.
Trotz allen Bemühungen um die Einbeziehung ökologischer Faktoren (etwa der Grünflächen und Bäume als „klimaverbessernder“ Faktoren, Temperaturausgleich und Filter gegen gasförmige Schadstoffe) [27] dürften auch die späteren Landschafts- und Grünordnungspläne nicht die beste Art und Weise sein, der zunehmenden Denaturalisierung des Lebensraumes und den Problemen der Verdichtung und der Belastung der Städte mit Schadstoffen zu begegnen. Die Wirkung der Pflanzen und Grünanlagen beseitigt nur die schlimmsten gesundheitsschädigenden Auswirkungen, nicht ihre Ursachen. Außerdem sind auch die städtischen Grünflächen und Parkanlagen nicht nur unnatürlich gestaltet, sondern auch durch ihre übermäßige Pflegebedürftigkeit sehr kostenaufwendig. Grünanlagen dagegen, in denen (aus Geldmangel) auf Pflege verzichtet wird, entwickeln sich manchmal zu naturnahen Ökotopen; allein dadurch könne man viele Kosten sparen, meinte Ulrich Hampicke schon Mitte der 80er Jahre. [28] Auch die oft geschmacklosen privaten Kleingärten oder Laubenkolonien bieten mehr Vielfalt und Artenreichtum, während sie die gleichen Aufgaben ohne zusätzlichen Kostenaufwand für die Stadtökologie erfüllen, ja sogar im Falle von Verpachtung Gewinn einbringen können. Der Verzicht nicht nur auf flächendeckende städtische Planungen, sondern auch auf Manipulation und Pflege der Natur oder ihre Privatisierung bringt somit sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich bessere Ergebnisse zustande als die aufwendigen Bebauungspläne mit peinlicher Beachtung von ordnungsmäßiger Einfügung der Natur in das Landschaftsbild, Einbringen von gebietsfremden und ordentlich zurechtgemachten Pflanzen und Vernichtung von sog. „Unkraut“ überall dort, wo es trotz ungünstiger Bedingungen zu wachsen versucht.
Die Vielzahl von Umweltvorgaben und diversen Festsetzungen in den Bebauungsplänen schränkt die Nutzungssouveränität und Gestaltungsmöglichkeiten der Eigentümer und damit deren Akzeptanz ein. Einen Teil von ihnen in tauschbare Nutzungsrechte oder Zertifikate umzuwandeln würde bessere Ergebnisse bringen, meinte beispielsweise Jürgen Bärsch 1996. [29] Dazu muß allerdings angemerkt werden, daß die inzwischen hochverschuldeten Kommunen heute eher dazu neigen, Grundstücke bedenkenlos zu verkaufen und dem Eigentümer zu fast beliebigem Gebrauch zu überlassen. Inwiefern dies eine positive Entwicklung darstellt, wird sich erst im Laufe der Zeit erweisen. Seitens der Wirtschaft wurde jedenfalls behauptet, daß ihre Standortpräferenzen mit den raumplanerischen Leitvorstellungen der „zentralen Orte“ in der Regel nicht übereinstimmen. Der planerische Ordnungsrahmen wurde zwar grundsätzlich nicht in Frage gestellt, er solle aber reformiert und in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft flexibel weiterentwickelt werden. [30] Trotz der weitgehend sinnentleerten Management-Phraseologie, die die ganze Argumentation durchzog (wie Wirtschafts- und Erlebnisraum, Standortmanagement und –marketing, Events, E-Business usw.) wurde ersichtlich, worauf es den Befürwortern eines anderen Ansatzes für die Stadtplanung ankam: weniger bürokratische Einschränkungen, keine festgelegten Ladenöffnungszeiten, mehr private Initiative und Privatisierung des öffentlichen Personennahverkehrs, aber auch weniger Denkmalschutz, mehr Platz für Werbung und mehr Freiräume für individuellen Verkehr, also Autos. Ob diese Reform auch im Sinne nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Mehrheit der Bürgert war, blieb fraglich. Zum Glück hat sich dieser seit den 70er Jahren bestehender Trend in Deutschland noch nicht ganz durchgesetzt. Privatisierung und Übertragung von öffentliche Leistungen an private Partner (etwa durch das sog. „PPP-Verfahren“) [31] hat nicht nur am Arbeitsmarkt oft wenig wünschenswerte Ergebnisse gebracht. In beiden Fällen blieb nämlich das auf der Strecke, was einzig von Bedeutung sein sollte, nämlich das Wohl der Einwohner und ihre Möglichkeit, über die Gestaltung ihres Wohnumfeldes selbst entscheiden zu können. Die wachsenden Interessenkonflikte zwischen Investoren und Einwohnern, die man mit dem Schlagwort „Gentrifizierung“ bezeichnet, sind das Ergebnis dieser falsch verstandenen Liberalisierung. Davon zeugt auch die wachsende Zahl von Protesten und Bürgerbegehren, die sich gegen planerische Großbauprojekte der Politik oder auch den unverantwortlichen Verkauf von Grundstücken an Private mit zuweilen schwer nachvollvolzeihbarwen Argumenten [32] und bedenklichen Folgen wehren.
Читать дальше