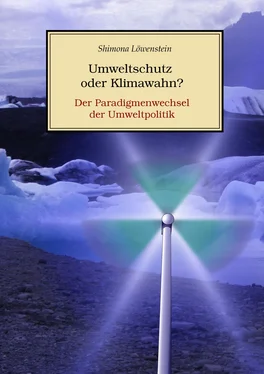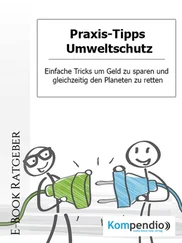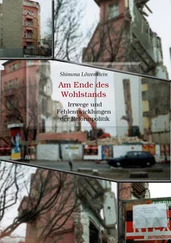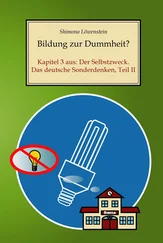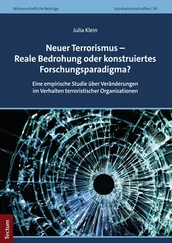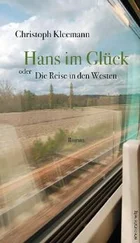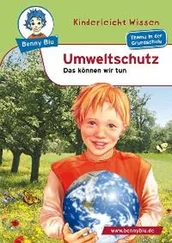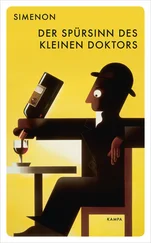1.3. Die „Bauern“: Nahrungshersteller oder Ressourcenvernichter?
Die Folgen der Urbanisierung (Bodenversiegelung) und der Industrialisierung (Vergiftung von Luft, Gewässern und Boden) für Natur und Umwelt sind inzwischen gut bekannt. Dagegen wird der weit größere Anteil der Landwirtschaft an der Naturzerstörung eher übersehen oder verharmlost. Die ökologischen Schäden der sog. „Landschaftsplanung“ betreffen nämlich nicht nur die Lebensräume bestimmter Tier- und Pflanzenarten. Der Anbau von Reinkulturen erhöht die Anfälligkeit der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge, womit der Einsatz von diversen Pflanzenschutzmitteln (Pestiziden, Fungiziden und Herbiziden) gerechtfertigt wird, der mit den „Schädlingen“ zugleich viele weitere Tier- und Pflanzenarten, einschließlich ihrer natürlichen Feinde (zum Beispiel der Vögel), ausschaltet und die ersteren langfristig immun werden läßt. Der mit der Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung zusammenhängende Einsatz von chemischen Düngemitteln führt wiederum oft zur Überdüngung (Überversorgung der Böden mit Stickstoff, Phosphat und Kalium), die Bodenerosion , Wasserverseuchung (vor allem durch Nitrate) [33] und Anreicherung der Schadstoffe in der Nahrung verursacht. Die subventionierte Ertragssteigerung wurde schließlich nur durch einen (ebenfalls subventionierten) überproportionalen Energieaufwand (Energiebeihilfen) erreicht. [34] Ein Teufelskreis selbstverursachter Scheinnotwendigkeiten wurde so geschaffen, der sich nur mit immer höherem Kosten- und Energieaufwand – bei sinkendem Grenznutzen – aufrechterhalten läßt.
An dieser offensichtlichen Fehlentwicklung ist die europäische Wirtschaftspolitik mit der Belohnung von ertragsintensiver Großproduktion mitverantwortlich. Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) zur Schaffung eines Gemeinsamen Agrarmarktes war von Anfang an eines der schwerwiegendsten und aufwendigsten politischen Vorhaben der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Die Ziele der GAP waren:
1 Nivellierung der Unterschiede der nationalen Landwirtschaften,
2 Steigerung landwirtschaftlicher Produktion,
3 Sicherung der Einkommen der europäischen Landwirte,
4 Schutz der europäischen Märkte für Agrarprodukte vor außereuropäischer Konkurrenz aus Drittländern.
Zu diesem Zweck wurden folgende Mittel eingesetzt:
1 Förderung von intensivierenden Maßnahmen zwecks Ertragssteigerung,
2 Garantie von Mindestpreisen für landwirtschaftliche Produkte,
3 Abnahmegarantien von Überschüssen der Mitgliedstaaten,
4 Einfuhrbeschränkungen und Zölle.
Finanziert wird die gemeinsame Agrarpolitik durch den 1962 geschaffenen Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL), der einen Großteil (heute immerhin noch 40 %) des gesamten EU-Haushaltes beansprucht.
Die anfangs für den gemeinsamen Agrarmarkt gesetzten Ziele (Angleichung und Intensivierung agrarischer Produktion, Sicherung der Einkommen der Landwirte) wurden bereits in den siebziger Jahren weitgehend erreicht, obwohl am Ende des Jahrhunderts erneut behauptet wurde, daß die Einkommen der Landwirte immer noch weit unter denen der übrigen Bevölkerung liegen. Inzwischen wurde jedoch immer mehr Aufmerksamkeit auf die ökologischen Aspekte der Landwirtschaft gerichtet. Aus der Diskrepanz zwischen wirtschaftlichem Nutzen (in diesem Fall der Landwirte) und den Umweltschäden schlossen Natur- und Umweltschützer sogar auf einen Widerspruch, ja Gegensatz zwischen Natur und Wirtschaft bzw. zwischen Ökologie und Ökonomie.
In Wirklichkeit war die Modernisierung der Landwirtschaft nach scheinbar rationalen betriebswirtschaftlichen Kriterien, die man einseitig im Sinne von Ertragssteigerung auffaßte, weder ökologisch noch ökonomisch rational. Schon die Heranziehung einzelwirtschaftlicher Kriterien , die aus makroökonomischem Gesichtspunkt irrelevant sein können, [35] ist eine fragwürdige Betrachtungsweise, weil sie die Wechselwirkung mit anderen Marktteilnehmern und der Umwelt außer Betracht läßt. Eine Produktionszunahme bzw. Ertragssteigerung eines Marktteilnehmers oder einer Branche muß demzufolge nicht immer das optimale gesamtwirtschaftliche Ergebnis bedeuten, sondern kann im Gegenteil die Gesamtwirtschaft belasten. [36] Nur die Berücksichtigung der gesamten Folgen und der geschätzten gesellschaftlichen Kosten könnte einen Einblick darin gewähren, inwiefern ertragssteigernde Investitionen und ihre Finanzierung durch Subventionen tatsächlich wirtschaftlich rational sind oder eher eine Fehlallokation von Mitteln darstellen, die man vielleicht auf eine andere Weise zum Wohl der Allgemeinheit oder zum Schutz der Natur hätte verwenden können.
Zu der großen finanziellen Belastung durch Agrarsubventionen müßten somit noch weitere Kosten hinzugerechnet werden, nämlich die zusätzlichen Kosten für Energie, Grundwasserverschmutzung und Gesundheit, die durch die genannten „externen Effekte“ der Landwirtschaft entstanden sind. „Die Öffentlichkeit und auch viele Spezialisten haben sich durch unvollständige Angaben der Landwirtschaft irreführen lassen. Es fehlen die Kosten für Energie und die Kosten, die die Gesellschaft für Umweltschutzmaßnahmen aufbringen muß, die bei dem intensiven Gebrauch von Maschinen, Düngemitteln, Pestiziden, Herbiziden und anderen stark wirkenden Chemikalien erforderlich werden.“ [37] Neuere Untersuchungen haben gezeigt, daß trotz der verschärften Vorgaben für Pflanzenschutzmittel diese externen Effekte (Rückstände in Trinkwasser und Nahrungsmitteln, Produktionsverluste, Biodiversitätsverluste usw.) weiterbestehen und damit hohe externe Kosten (Regulierung, Kontrolle und gesellschaftliche Folgekosten) in beträchtlichem Umfang verursachen. [38] Daraus schloß man, daß ordnungspolitische Instrumente (gegenüber den ökonomischen) ineffektiv sind. [39]
Überdies handelt es sich bei der Garantie von Mindestpreisen um einen klassischen Fall von direkten Eingriffen in die Preisbildungsmechanismen, der ein Überangebot hervorbringt – also den umgekehrten Fall von dem durch die Festsetzung von Höchstpreisen erzielten Unterangebot. Wenn sich Preise für landwirtschaftliche Produkte, wie auch bei allen anderen Gütern, auf dem freien Markt bilden würden, so lehrt die klassische Theorie, entstünde langfristig ein Gleichgewichtspreis mit der entsprechenden Gleichgewichtsmenge des angebotenen und zugleich nachgefragten Produktes. Wird aber ein Mindestpreis festgesetzt, der höher liegt als der Gleichgewichtspreis, entsteht ein Angebotsüberschuß, d.h. die angebotene Menge ist viel größer als die bei diesem Preis nachgefragte. Darin liegt die Ursache für die so entstandenen landwirtschaftlichen Überschüsse . Da alle Märkte in Wechselwirkung zueinander stehen, breiten sich Deformationen eines Marktes auf andere Märkte aus und verursachen Verzerrungen in der gesamten Volkswirtschaft. [40]
Durch die gewährten Absatzgarantien haben sich die Überschüsse weiter vergrößert, denn diese bilden einen starken Anreiz für intensivierte Bewirtschaftung (einschließlich Stickstoffdüngung und Pflanzenschutzmitteleinsatz) und zur Überproduktion samt aller damit verbundenen ökologischen und ökonomischen Folgen. Der Landwirt produziert somit unabhängig davon, ob er seine Produkte verkaufen kann oder nicht, denn die Überschüsse muß der Staat aufkaufen, lagern oder beseitigen. Daß man die sinnlos erwirtschafteten Überschüsse überdies nicht einmal dazu verwendet, um etwa hungernden Menschen in der Dritten Welt zu helfen, sondern daß sie auf Kosten der Allgemeinheit aufbewahrt und sogar vernichtet werden müssen, ließe sich als widersinnig und amoralisch werten, aus rein wirtschaftlicher Sicht zumindest als eine gigantische Ressourcenverschwendung . Der Verbraucher, der in der Regel mit dem Steuerzahler identisch ist, wird im Endeffekt gleich mehrfach geschädigt. Er muß:
Читать дальше