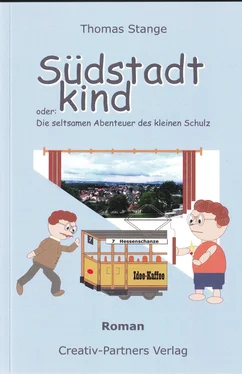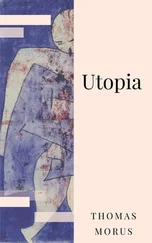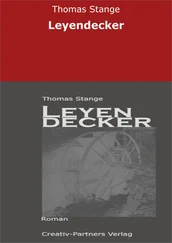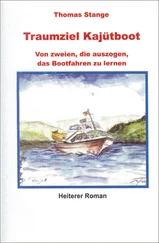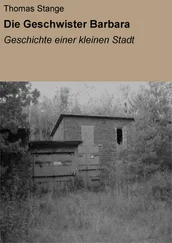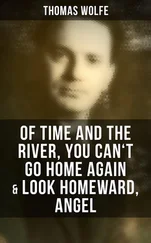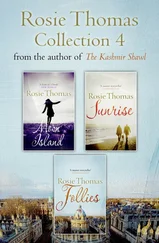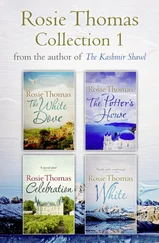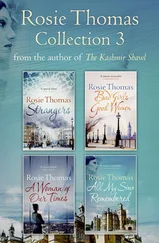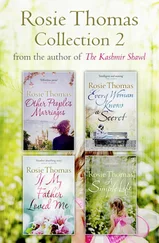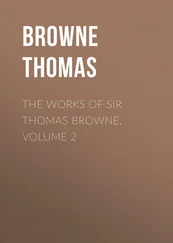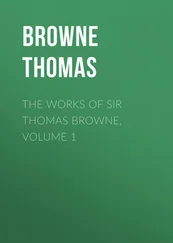Doch der kleine Schulz hatte noch einen weiteren Freund. Dieser Freund war so ganz anders, als die Jungen aus der Nachbarschaft. Das mochte zum einen daran liegen, dass dieser viel älter war als die anderen Freunde vom kleinen Schulz. Und eigentlich war er auch schon viel zu alt, um ein Freund vom kleinen Schulz zu sein, zu alt, um sich mit so einem kleinen Jungen wie dem kleinen Schulz abzugeben. Schließlich zählte er bereits zwölf Lenze und der kleine Schulz brachte es gerade einmal auf deren fünf.
Trotzdem war Rainer – so hieß der Junge nämlich – der Freund vom kleinen Schulz, denn Rainer war eben anders. Anders als andere Zwölfjährige. Stiller, leiser als andere. In sich gekehrt. Voller Phantasie. Voller Träume. Voller Interesse für alles Technische. Doch war er mit einem schlimmen Handicap belastet, überhaupt und besonders für einen Zwölfjährigen: Rainer fiel es sehr schwer, sich zu artikulieren. Nicht, dass er nicht hätte sprechen können, nicht, dass er gestottert hätte, nicht, dass er unfähig gewesen wäre zu einem klaren Gedanken.
Nein, es waren einfach die Worte, die bei ihm nicht fließen wollten, besonders, wenn er unter Druck stand, wenn er aufgefordert wurde zu sprechen, etwa von anderen Kindern oder vom Lehrer in der Schule oder von seinen Eltern, die damals noch kein Verständnis für seine Behinderung hatten und meinten, ihr Sohn müsse sich doch nur gefälligst zusammenreißen, denn er könne doch sprechen, wenn er nur wolle.
Immer wenn es so kam, stockten Rainer die Worte. Wer ihn dabei beobachtete, mit offenen Augen und offener Seele, der konnte sehen, konnte fühlen, wie sich die Worte, die Sätze in seinem Kopf stauten, wie sie sich drängten auf ihrem Weg zu seiner Kehle, seinen Stimmbändern, um hinaus zu gelangen, der konnte Zeuge werden des Kampfes, den der Junge dabei mit sich selbst ausfocht und der manchmal in Form eines wilden Wortschwalles zu seinen Gunsten ausging, den er jedoch sehr viel häufiger verlor.
Rainer und der kleine Schulz waren die besten Freunde. Denn in Gegenwart vom kleinen Schulz hatte Rainer nie das Gefühl, Rede und Antwort stehen zu müssen, denn der kleine Schulz erwartete von Rainer nichts, außer dass der ihn an seiner Phantasie, an seinen Träumen und seinem Wissen teilhaben ließ. Doch der Reihe nach.
Alle zwei Wochen, zumeist an einem Mittwoch oder Donnerstag, nahm Mutter Schulz nach dem Mittagessen ihren Sprössling zur Hand, tauschte dessen Räuberzivil gegen einen gesellschaftsfähigen Anzug, machte sich selber stadtfein, nahm ihren Jungen an die Hand und verließ die Wohnung. Hand in Hand ging es das kurze Stück die Auestraße hinauf bis zur Frankfurter Chaussee, von dieser gegenüber die Tischbeinstraße abzweigt. Wer dort hinwollte, hatte zuvor vier Fahrspuren plus zwei Straßenbahngeleise zu überqueren. Es galt also abzuwarten, bis die Fußgängerampel auf grün springen und damit den Weg freigeben würde.
Als Mutter Schulz nebst Anhang die Kreuzung erreichte, wechselte die Fußgängerampel gerade von Grün auf Rot. Die Auto- und Lastwagenwelle, ampelgebändigt, brandete ohrenbetäubend, angsteinflößend, Qualm verbreitend auf und rollte brüllend die „Beamtenlaufbahn“ hinauf; Hupen, Quietschen, Heulen, Knattern, in schwarz, weiß, grau und braun – der kleine Schulz kam sich vor wie im Paradies. Seine Augen huschten von PKW zu LKW zu PKW im schnellen Erfassen, Erkennen und Klassifizieren jedes einzelnen Autotyps, jeder Lastwagenbauart, denn der kleine Schulz war ein Junge seiner Zeit, und alle Automarken zu kennen und zu erkennen war für einen richtigen Jungen Ehrensache.
Dann begannen die ersten Autos abzubremsen, die Welle schien wieder zum Stillstand kommen zu wollen. Dann verharrten die Autos, und die Fußgängerampel sprang auf Grün. Mutter Schulz fasste ihren Sohn fester und marschierte schnellen Schrittes los. Die aus der Tischbeinstraße nach rechts auf die Frankfurter Straße abbiegenden Autos hatten den querenden Fußgängern Vorrang zu gewähren. Mutter Schulz maß das zuvorderst haltende Auto samt dessen Fahrer mit bitterbösem Blick, auf das er ja nicht auf die Idee kommen solle anzufahren, während sich Frau Schulz noch auf der Fahrbahn befand.
Dann war das rettende Trottoire auf der anderen Straßenseite erreicht und der kleine Schulz strebte neugierig zu dem an der Ecke befindlichen Blumenladen, denn bei dem gab es Blumensträuße aus dem Automaten, was dem kleinen Schulz wie das achte Weltwunder erscheinen wollte. Mutter Schulz indes würdigte den Automaten keines Blickes; Automatenblumen widersprachen ihrem Weltbild fundamental.
Weiter ging es nun die Tischbeinstraße entlang, vorbei an den Garagen der Autowerkstatt, deren große Blechtore den kleinen Schulz auf merkwürdige Weise erschauern ließen. Dann kam die kleine Tankstelle, die von all‘ jenen Autofahrern gern genutzt wurde, die vom Stadtteil Wehlheiden in die Südstadt und von dort weiter ins Zentrum wollten und zur Sicherheit noch ein paar Liter Benzin mit auf den Weg zu nehmen gedachten.
Dann kam auf der anderen Straßenseite bereits das große Gebäude der Druckerei in Sicht und noch eine Tankstelle – und der Abzweig mit den geheimnisvollen Straßen, die von dort kopfsteingepflastert links und rechts den Weinberg hinauf und hinab führten.
Hatten wir schon erwähnt, dass der kleine Schulz vom lieben Gott mit einem großen Vorrat an Phantasie versehen worden war? Alles, was er nicht kannte, war für ihn nicht einfach nur neu, sondern höchst geheimnisvoll. Wege, die er noch nicht gegangen war, wo mochten sie hinführen? Welche Geheimnisse mochten sich an ihrem Ende verbergen? Straßen, die er nicht einfach kennen lernte, sondern entdeckte; welche neuen Einblicke in die Welt mochten sie vor seinen, des kleinen Schulz‘, Augen verbergen?
Und so war es eben auch mit den harmlosen Nebenstraßen, die die „Tischbein“ mit dem Wohngebieten am Südhang des Weinberges verbanden; jedes Mal, wenn der kleine Schulz an der Hand seiner Mutter an ihnen vorbei kam, fühlte er sich erneut von deren Geheimnissen fasziniert.
Vielleicht sollte man an dieser Stelle anmerken, dass die Tischbeinstraße die Stadtteile Wehlheiden und Südstadt miteinander verbindet und dabei durch einen tiefen Taleinschnitt führt, der auf der einen Seite vom Südhang des Weinberges und auf der anderen vom Nordhang des Auefeldes begrenzt wird. Was für den kleinen Schulz die Wanderung an der Hand der Mutter zum Faszinosum machte. Welche Geheimnisse bargen die Berge zur Rechten und zur Linken? Was war dort oben? Wie sah es dort aus? Welche Abenteuer warteten dort darauf, vom kleinen Schulz endlich erlebt zu werden? Fragen über Fragen, durchträumt vom kleinen Schulz, während er gedankenversunken an der Hand seiner Mutter daher tändelte.
Vorbei geht es nun an dem Kiosk, der sich auf der anderen Straßenseite befindet und zu dessen Passage Mutter Schulz lieber die gesamte Straßenbreite zwischen sich und ihm weiß, denn es steht „Trinkhalle“ an der Bretterbude angeschlagen, und man weiß schließlich nie, wer dort so alles trinkt und in welchem Zustand der sich gerade befindet, und überhaupt und schon gar nicht, wenn sie das Kind dabei hat. Das Kind hätte gerne ein Eis gehabt, denn es ist warm an diesem Sommertag, und Eis gibt es in solch kleinen Geschäften, das weiß der kleine Schulz und sieht deshalb die Trinkhalle mit einigem Bedauern in seinem Rücken entschwinden.
Sie sind nun schon eine ganze Weile unterwegs, eine halbe Stunde vielleicht, die Straße zieht sich dahin, und der Weg ist eigentlich ziemlich weit für einen kleinen Jungen, doch der ist das ja gewöhnt, schließlich ist er gut im Training, von den Märschen in die Stadt mit seiner Großmutter, weshalb er auch nicht quengelt oder zaudert, als die Mutter jetzt an einem Fußgängerüberweg verhält, demonstrativ nach rechts und nach links schaut, „Die Straße ist frei“ sagt (denn das Kind soll stets etwas fürs Leben lernen), und dann forschen Schrittes die Straße überquert.
Читать дальше