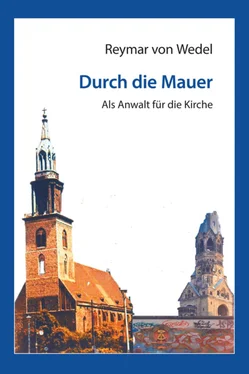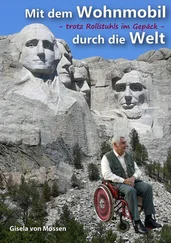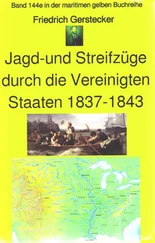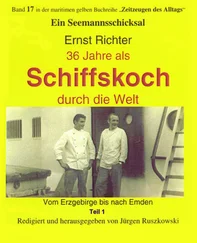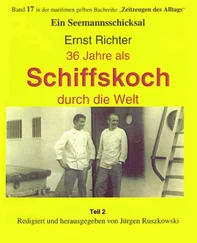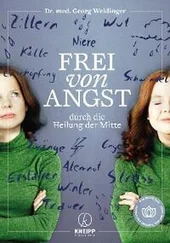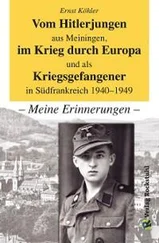Wie konnten Einheit und Handlungsfähigkeit der Kirche erhalten bleiben, wenn die DDR die Grenzen völlig sperren würde? Die Teile mussten als handlungsfähige Glieder konstituiert werden. Die befragten Juristen hielten dies für möglich. Dazu war allerdings eine Änderung der Verfassung erforderlich.
Scharf trug seine Gedanken der noch gemeinsamen Kirchenleitung vor. Vor allem die Mitglieder aus Westberlin reagierten verständnislos. Die Befürchtung, dass die Sektorengrenze völlig gesperrt werden könnte, sei unrealistisch. Die DDR könne nicht ohne Zustimmung der Sowjetunion handeln. Diese müsse mit einer scharfen Reaktion der USA rechnen. Selbst militärische Maßnahmen seien nicht ausgeschlossen. Auch sei Berlin durch eine Fülle von Straßen verbunden wie ein lebendiger Körper. Eine totale Sperre sei auch aus technischen Gründen nicht möglich. Daher seien Maßnahmen, die eine solche Sperre voraussetzen, defätistisch. Sie schwächten zudem den Willen zum Widerstand. Sie schadeten der Gemeinsamkeit der Berliner Bürger. Sie führten dazu, die Schwestern und Brüder im Osten im Stich zu lassen.
All diesen Einwänden gegenüber beharrte Kurt Scharf darauf, dass das entscheidende Ziel seiner Vorschläge die von Gott geschenkte Einheit der Kirche und ihrer Handlungsfähigkeit sei. Demgegenüber seien alle politischen Erwägungen zweitrangig. Die Einheit der Kirche werde aber auch allen politischen Zielen der DDR, der Abgrenzung ihres Staatsgebietes und damit der Spaltung der Kirche entgegenwirken. Sie sei ein Akt des Widerstandes dagegen, nicht aus politischen, sondern aus geistlichen Gründen.
Der Vorsitzende, Bischof Dibelius, schwieg lange. Er war wie die Kritiker politisch westlich orientiert. Aber er war Realist und sah wie Scharf die politische Gefahr. Auch hatte er als Bischof die Einheit der Kirche zu wahren. Er durfte sie nicht zerbrechen lassen. In seinem Votum unterstützte er Scharf. Dies überzeugte die widersprechenden Mitglieder der Kirchenleitung. Sie beauftragten das Konsistorium, einen Entwurf für eine Notverordnung vorzubereiten.
In diesem Entwurf wurde noch einmal die unzerstörbare Einheit der Kirche bekräftigt. Im Falle der Trennung sollten die Funktionen der gemeinsamen Leistungsordnung auf die Gremien der jeweiligen Region übertragen werden. Das einheitliche Bischofsamt sollte bestehen bleiben. Der neue Bischof sollte von beiden Regionen gewählt werden.
Der Entwurf wurde den Synodalen zugestellt. Damit wurde er bekannt. Die Presse reagierte aufgeregt und empört. Alles, was in der Kirchenleitung kritisiert worden war, wurde wieder vorgebracht. Selbst der Regierende Bürgermeister Willy Brandt äußerte sich in diesem Sinne.
Die Notverordnung der Kirchenleitung wurde der Synode vorgelegt. Scharf begründete sie vor dem Plenum. Im Fall der Trennung sollten die verschiedenen Regionen selbständig handeln dürfen. Sie sollten jedoch in enger Zusammenarbeit wirken. Ein Bischof sollte gemeinsam gewählt werden. Nach Scharfs Vortrag stimmte die Synode dem Entwurf zu.
In diesem Zusammenhang beauftragte mich Scharf, Justitiar für den Ostbereich zu werden. Zu diesem Zweck sollte ich als Anwalt zugelassen werden, damit ich auch in Ostberlin mit den Behörden in der DDR verhandeln konnte.
5. Der Kirchentag und die DDR
1961 sollte ein Kirchentag in Berlin stattfinden. Aber die Regierung der DDR bot plötzlich stattdessen Leipzig an. Dort hatten die Christen 1954 aus ganz Deutschland glücklich miteinander gefeiert. Auch Politiker aus den beiden deutschen Staaten hatten teilgenommen. Staatspräsident Wilhelm Pieck und Bundestagspräsident Hermann Ehlers hatten neben-einander gesessen. Der spätere Bundespräsident Gustav Heinemann hatte Bibelarbeiten gehalten. Auch Scharf war damals begeistert. So hätte ein Kirchentag in Leipzig ein schönes Vorbild und ein Zeichen der Zusammengehörigkeit aller Christen in Deutschland und damit der EKD werden können.
Aber die Regierung der DDR wollte die Zahl der Teilnehmer aus der Bundesrepublik begrenzen. Sie wollte auch Einfluss auf ihre Auswahl ihrer Teilnehmer nehmen. Einige Prominente, wie Dibelius und Kunst (Bevollmächtigter der EKD in Bonn), sollten von vornherein ausgeschlossen sein. Die großen Messehallen in Leipzig sollten für Veranstaltungen des Kirchentages geschlossen bleiben. Das konnte die Kirche nicht hinnehmen. Sie blieb daher endgültig bei Berlin. Scharf teilte dies dem Staatssekretär für Kirchenfragen mit. Darauf erklärte die Regierung der DDR durch Walter Ulbricht, der Kirchentag dürfe nicht in Ostberlin stattfinden.
Die Kontrollen dahin wurden tatsächlich während des Kirchentages für alle Teilnehmer radikal verschärft. Dennoch gelang es Zehntausenden, aus der DDR nach Ostberlin zu kommen. Sie kamen über die Felder zwischen den Straßen und Eisenbahnlinien und strömten noch weiter über die Sektorengrenzen nach Westberlin. Zehntausende kamen auch aus der Bundesrepublik. Sie drängten nun ihrerseits nach Ostberlin. Die Innenstadt über die Museumsinsel hinaus war schwarz von Kirchentagsbesuchern.
Im Dom, in der Marienkirche und in der Sophienkirche fanden die Eröffnungsgottesdienste statt. Drei Tage konnten die Besucher in Kirchen- und Gemeindehäusern diskutieren. Am Schlusstag versammelten sich hunderttausend Besucher im Westberliner Olympiastadion. Scharf predigte von der Stelle aus, wo sonst Fußballspiele angestoßen werden. Sein Schlusssatz lautete: »Nun geht zurück in eure Gemeinden, wo Gott euch hingestellt hat.« Die Regierung der DDR griff nicht ein. Erst später erklärte Walter Ulbricht, der Kirchentag habe die Errichtung der »Friedensgrenze« verzögert.
Am 13. August 1961 errichtete die DDR die Berliner Mauer. Viele Bürger versuchten, nach Westberlin zu fliehen. Viele von ihnen wurden dabei festgenommen, einige sogar erschossen. Dagegen protestierte Scharf zusammen mit anderen Theologen in einem öffentlichen Telegramm Darin forderte er die DDR auf, die Festgenommen freizulassen und Möglichkeiten zu schaffen, deren getrennte Familien zusammenzuführen.
Darauf wurde Scharf zum Oberbürgermeister in Ostberlin vorgeladen. Dieser erklärte ihm im Beisein des Polizeipräsidenten, die Regierung könne seine Erklärung nicht hinnehmen. Wenn ihm die Politik der DDR nicht gefalle, könne er die DDR verlassen. Scharf lehnte dies jedoch ab und bat erneut, die Gefangenen freizulassen. Dies lehnte der Oberbürgermeister ab.
Als Ratsvorsitzender der EKD wollte Scharf an einer Sitzung in Westberlin teilnehmen. Er beantragte daher eine Genehmigung, die Grenze nach Westberlin zu überschreiten. Diese wurde ihm auch erteilt. Als er jedoch am 31. August 1961 nach Ostberlin zurückkehren wollte, wurde er von zwei Beauftragten des Ministeriums für Staatssicherheit zurückgeschickt. Ihm wurde sein Ausweis abgenommen.
Er war damit ausgewiesen, obwohl es dafür keine verfassungsrechtliche Grundlage gab. Die Ausweisung war ein Akt der Willkür.
In Westberlin bemühte sich Scharf sofort, den Kontakt mit der Ostregion wieder herzustellen. Mit einem ersten Versuch beauftragte er mich. Über einen Kurier verabredete ich ein Treffen mit einem Ostberliner Theologen; wir wollten uns auf der Bundesstraße 5 nach Hamburg treffen. Dies sollte an einem bestimmten Kilometerstein geschehen. An diesem Treffpunkt traf ich mich mit dem Oberkirchenrat Hootz aus der regionalen Kirchenleitung im Osten. Ich übergab ihm Urkunden und Medikamente, die in der DDR nicht zu erhalten waren. Als wir uns trennen wollten, bemerkten wir, dass in der Nähe ein Mann von einem Baum hinabstieg. Er hatte uns offensichtlich beobachtet. Hootz kehrte nach Ostberlin zurück, wurde kurz kontrolliert, konnte aber weiterfahren. Ich fuhr über Helmstedt nach Westberlin zurück.
Dieser Versuch konnte nicht wiederholt werden. Scharf fand aber bald andere Wege. So bat er die Geistlichen der Besatzungsmächte um Hilfe. Diese wurden an der Sektorengrenze nicht kontrolliert. Insbesondere der französisch-reformierte Pfarrer brachte jeden Monat einen Koffer mit Bannware zu dem oben genannten Theologen Hootz. Auch der Seelsorger der schwedischen Gesandtschaft war als Kurier tätig. Für den laufenden Verkehr der Kirchenleitungen sandten Bruderkirchen aus dem Westen Vikare. Diese durften nach Ostberlin einreisen. Sie berichteten jeweils der anderen Region. Da sie jede Woche ausgewechselt wurden, bemerkte die Grenzpolizei sie lange Zeit nicht. Später wurden sie aufgrund der Auflockerung durchgelassen.
Читать дальше