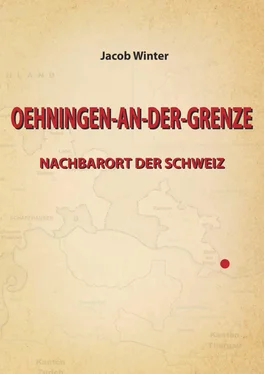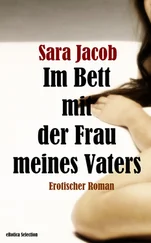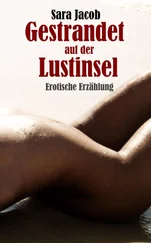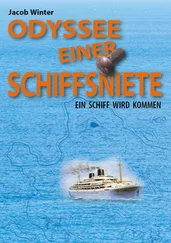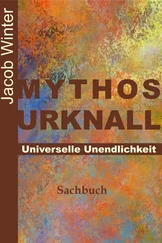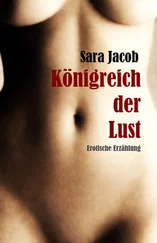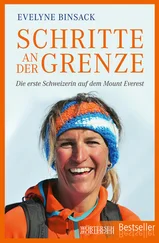In früheren Zeiten wurde die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz nur mittels Granitgrenzsteine markiert, doch heutzutage werden die im GPS-Zeitalter eigentlich nicht mehr direkt gebraucht. Es stellt sich daher die Frage, was mit diesen alten, teils von Moos und Flechten überwucherten, manchmal auch schief stehenden Grenzsteinen geschehen soll. Denn immerhin handelt es sich trotz des Beitritts der Schweiz zum Schengen – Abkommen noch um eine echte Staatsgrenze, die nicht nur – wie bereits gesagt – EU-Außengrenze ist sondern auch zusätzlich die Grenze zwischen dem NATO-Militärbündnis und einem neutralen Staat.
Diese alten CH/D-Grenzsteine werden auch heutzutage immer noch ausgewechselt und erneuert. Die alten Grenzsteine (ca. 30 x ca. 30 cm mit einer Länge von bis zu 2.00 m), die jahrzehntelang treu gedient haben, werden aber nicht einfach entsorgt, sondern weiterhin aufbewahrt und manchmal an repräsentativer Stelle wieder aufgestellt: Wie beispielsweise im Ramsen am Rathaus und in Rielasingen bei Hotel Krone. Angesichts des Gewichts von rund jeweils rund 300 Kilo jedoch keine sehr leichte Aufgabe. Die neu gesetzten Betongrenzsteine bekommen allerdings nicht mehr die Inschriften GB und CS mit der Jahreszahl 1839 und dem Zusatzbuchstaben bezüglich der Anliegergemeinde (mit dem ersten Buchstaben derselben), sondern neben der Nummer nur noch D und S sowie das Jahr der Neuaufstellung.
Bei den alten Grenzsteinen bedeutet übrigens GB = Grossherzogtum Baden und CS = Canton Schaffhausen, während die Zahl 1839 sich auf den „Grenzberichtigungsvertrag“ von 1830 zwischen der Schweiz und Baden bezieht. Dieser Grenzvertrag wurde dann 1839 mittels weitläufiger Grenzstein-Vermarkung in die Tat umgesetzt. Insgesamt wurden die rechtsrheinischen Schweizer Gebiete – und da speziell der Kanton Schaffhausen – durch etwa 1740 Stück je 300 Kilo schwere Grenzsteine (inklusive Fundament) von Deutschland getrennt – die wie gesagt ab 1839 aufgestellt wurden. Dieser Grenzvertrag wird auch heute noch kontrolliert.
Maßgeblich hierfür war das diesbezügliche Grenz-Abkommen von 1839 „Einigung der Grossherzoglich badischen Staatsregierung und der Eidgenossenschaft von 1839“: „Da, wo die Landesgrenze bisher unbestritten gewesen ist, sollen die bereits bestehenden Marksteine als maasgebend betrachtet werden; sie sind jedoch sämtlich, einerseits mit den Buchstaben GB-Grossherzogtum Baden, so wie mit der Jahreszahl 1839, andererseits aber mit den Buchstaben CS-Canton Schaffhausen, so wie mit einer fortlaufenden Nummer zu bezeichnen; auch ist auf den Kopf derselben das betreffende Winkelmaas einzuhauen“.
Hierzu ist ergänzend zu sagen, dass die durchgehende Linie auf dem Kopf eines Grenzsteines, sowohl bei den alten wie auch bei den neuen Grenzsteinen, der so genannte „Weiser“ ist (auch „Weisung“ genannt), der m Gesetzestext mit „Winkelmaas“ bezeichnet wird. Er zeigt die jeweilige Richtung der nächsten Grenzsteine an, das angesetzte kurze Stück dagegen weist zum genauen Grenzpunkt, beispielsweise die Flussmitte.
GRENZÜBERGANG FROSCHENGÄSSLE (Öhningen)
RHIGÜETLIWEG (Stein am Rhein)
RADWANDERWEG
Das Froschengässle (auf deutscher Seite) und der Rhigüetliweg (auf Schweizer Seite) verlaufen entlang dem Rhein auf flachem Gelände und sind als weiterer Grenzübergang zwischen Öhningen und Stein am Rhein anzusehen – allerdings auf der deutschen Seite nur für Radfahrer und Wanderer. Der Rhigüetliweg zweigt von der Oehningerstraße ab und bis zur Grenze unweit von Öhningen ist der Rhigüetliiweg hier asphaltiert und der PKW-Verkehr für Anlieger und Landwirtschaft erlaubt.
Auf dem Schotter-Teilstück auf Öhninger Seite ist das Froschengässle nur als Fahrradweg bzw. als Wanderweg markiert. An der Grenze selbst ist die PKW-Durchfahrt in Richtung Öhningen normalerweise mittels zweier weissroter Pfosten auf dem Asphalt blockiert. Die Grenze verläuft hier ab dem Rhein schnurstracks in nördlicher Richtung bis Grenzstein 425 an der Steiner Straße, teilweise entlang einem kleinen Bach-Rinnsal („Grenzbach“). Wegen der Corona-Pandemie aber vor allem wegen uneinsichtiger Autofahrer war auch dieser Grenzübergang mit Betonpollern verbarrikadiert worden – man glaubt es nicht!

Schweizer und deutsches Hoheitsschild.

Rhigüetliweg mit Grenze und Uferwanderweg.

Rhigüetliweg mit Grenze und Uferwanderweg.
Etwa 50 m zurück in Richtung Schweiz steht ein Schweizer, gusseiserner Grenzpfahl mit einem sehr schönen gusseisernen Hoheitsschild des Kantons Schaffhausen. Meistens stehen die in direktere Nähe zu Grenzsteinen doch an diesem Radfahrer-Grenzübergang ist dies nicht so, Es gibt hier direkt am Weg keinen Grenzstein, während es am Hauptgrenzübergang zwar beidseitige Grenzsteine gibt – doch kein Schweizer Hoheitsschild. Dafür gibt es an beiden Grenzübergängen je ein deutsches (unbeschädigtes) Hoheitsschild in gelb mit schwarzem Adler.

Rhigüetliweg mit Wegeschmuck.

Radwegdistanzen

CH-Hoheitszeichen
Auf der Schweizer Seite befindet sich auf der Rheinseite ein großer Bauernhof mit der Adresse Rhigüetl 1. Auch ist der Rhigüetliweg hier mit großen Metallkugeln künstlerisch aufgewertet worden – und kein „Wildnis“ wie auf der deutschen Seite.
Vom Fröschengässle geht kurz vor dem Grenzübergang der Pontonierweg als Uferwanderweg zum Untersee hinunter. Mit der grenzüberschreitenden Brücke EXPO 2002 („Regenbogen-Brücke“) auf diesem Wanderweg entlang dem Untersee ist eine nette EU-Geschichte verbunden, die hier im Rahmen einer deutsch-schweizerischen Verständigung durchaus erwähnt werden darf.
 |
426 oben auf Hügel |
 |
Grenzstein 426 steht hoch oben im Feld einige hundert Meter entfernt und trägt die Jahreszahl 1935. Merkwürdig ist das kein D (für Deutschland) sondern ein B (für Baden-Württemberg?) eingeritzt ist. Die „Weisung“ oben auf dem Stein ist ein gerader Strich in Richtung Untersee. Oben am Steiner Weg beim offiziellen Grenzübergang stehen übrigens die beiden 1839 – Grenzsteine 425 und 424.
Читать дальше