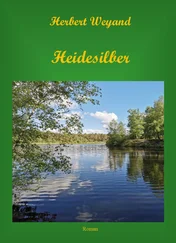»Frau Winter wir sind fassungslos. Wir haben keine Erklärung für die Hämatome.«
Ihr Geist entschwand wieder. Einhundertfünf Tage waren seit ihrem letzten bewussten Gedanken vergangen.
Jana Winter hielt die Augen geschlossen. Sie wollte die Neonleuchte nicht sehen. Sie lauschte. Geräusche von Maschinen, die sie lediglich aus dem Fernseher kannte, drangen an ihr Ohr. Jana öffnete vorsichtig die Augen und ließ den Blick sofort nach links schweifen und fokussierte an einem Fenster, gegen das dicke Regentropfen schlugen. Aus den Augenwinkeln nahm sie die bekannte Lampe an der Decke wahr. Wieder wurde ihre Wahrnehmung unterbrochen und sie versank in Schwärze. Zweiundneunzig Tage waren nach ihrem letzten Erwachen vergangen.
Weitere dreihunderteinundsiebzig Tage später flutete die tief stehende Sonne in ihre Augen. Ihr Erwachen war anders. Sie spürte Lebensenergie und nicht dieses träge Dahingleiten. Ihre Gedanken arbeiteten sofort auf Hochtouren. In der Abdeckung der Neonleuchte lagen neue tote Insekten.
Jana löste den Blick und hob den Arm. Eine Kanüle auf der Handoberfläche, von der drei Schläuche irgendwohin abgingen. Da war Druck um ihren Kopf. Aus den Augenwinkeln bemerkte sie medizinische Geräte, in die eine Vielzahl von Kabel führte. Der gleichmäßige Piepton war wohl ihr Puls. Krankenhaus … sie war in einem Krankenhaus. Janas Verstand glitt wieder weg, doch die Geräusche blieben.
»Unglaublich. Das Herz schlägt alleine, die körperlichen Funktionen und Reflexe sind wieder normal.« Die Stimme war ihr unbekannt.
»Das heißt tatsächlich, sie ist aus dem Koma erwacht?« Das war Opa. Er klang, als weine er.
Koma? Unmöglich. Sie war vorhin noch auf dem Markt. Jetzt lag sie hier. Wegen der Kopfschmerzen? Jana öffnete mühsam die Augen und sah in das glückliche Gesicht ihres Großvaters, der ungeniert seinen Tränen freien Lauf ließ. Sie versuchte zu sprechen, bekam jedoch keinen Ton heraus.
»Sei still Kind. Streng dich nicht an.« Der Großvater streichelte ihre Wangen. »Papa und Mama werden gleich hier sein. Ich habe sie sofort angerufen.«
Jana hob den Kopf aus dem Kissen. Eine Krankenschwester half ihr sofort und richtete das Kissen. Der Druck am Kopf war verschwunden, ebenso die Geräte, die sie vorhin – oder wann? – bemerkt hatte, bis auf einen kleinen Monitor, der Kurven ihrer Lebensfunktionen abbildete. Vom Handrücken lief noch ein Schlauch, zu einer Flasche, aus der irgendetwas in ihre Adern tropfte. Sie wandte den Blick zum Fenster, das zumindest vorhin noch dort war. Jetzt lag es an der anderen Seite der Wand. Träumte sie? Nein, das war ein anderes Zimmer.
Was ist los?, wollte sie fragen. Doch wieder kam kein Laut über ihre Lippen.
»Du bist vorgestern aus dem Koma erwacht.« Opa verstand sie, auch ohne Worte. »Jetzt musst du dich gesund schlafen.«
Jana schloss die Augen und schlief ein.
Das nächste Mal, als sie erwachte, war es Nacht. Über der Tür brannte eine kleine Notbeleuchtung. Der Monitor flackerte und gab die gleichförmigen Pieptöne ihrer Lebensfunktionen wieder. Ihre Gedanken waren träge und ziellos. Dennoch lenkten sie die Augen zum Fenster. Der Regen hatte aufgehört und Janas Blick wurde magisch vom Sternbild der Zwillinge angezogen. Castor und Pollux. Die Angst überfiel sie, wie ein Schlag und zog die Eingeweide zusammen. Von diesen beiden Sternen ging Gefahr aus, die sie nicht fassen konnte.
Sie erinnerte sich deutlich an alles, viel zu deutlich, als sie in den Herbsthimmel sah. Sie wusste, was geschehen war, gerade jetzt und in diesem Augenblick. Ihr Atem begann zu hecheln und Schweiß drang aus den Poren. Sie zwang sich in sitzende Stellung und brachte ihren Atem unter Kontrolle. Sie horchte nach draußen auf den Korridor, der jedoch still war. Sie wollte nicht, dass jemand sie so sah.
Vor wenigen Minuten stand sie mit Zerbi vor der Wand, durch die sie hindurch schritt, bevor sie in Dunkelheit versank. Diese Dunkelheit … immer wieder diese Dunkelheit …
*
Vor zwei Jahren lief Jana, von der Mayrschen Buchhandlung, in Aachen, zum Westbahnhof. Am 13. Oktober 2011, ihr Geburtstag. Sie wurde sechzehn Jahre alt. Zu diesem Anlass löste sie eines ihrer Geschenke, einen Gutschein, für den neuen Harry Potter ein. Auf dem Markt, in Höhe des Kaiser Karl Denkmals, sah sie den hellen Blitz und dann nichts mehr. Doch, da war noch etwas. Ein Schatten, der sich zwischen sie und das helle Licht schob. Aber das konnte auch Einbildung sein. Vom Zeitpunkt ihrer Ohnmacht bis heute wusste sie lediglich aus den Erzählungen ihrer Eltern, was geschehen war. Zumindest glaubte sie das fest.
Sie wurde damals in einem Hubschrauber ins Klinikum geflogen und jetzt, nach etwas mehr als zwei Jahren, entlassen. Von der Zeit des Krankenhausaufenthalts blieb die Erinnerung an die letzten sechs Wochen. Zumindest dachten das die Ärzte sowie Mama und Papa. Sie war wohlauf. Niemand fand eine Erklärung für den Ausfall ihrer Lebensfunktionen.
Die letzten sechs Wochen verliefen ereignisreich. Vier Tage nach ihrem Erwachen wurde der letzte Zugang auf ihrem Handrücken gezogen. Noch während die Krankenschwester die Kanüle zog, schwang Jana die Beine aus dem Bett und stand frei im Raum. Die beiden Ärzte und die Krankenschwester schrien auf und hilfreiche Hände zuckten zu ihr hin, die jedoch gleich wieder zurückgezogen wurden.
»Habe ich etwas falsch gemacht?«, fragten ihre Augen.
»Nein. Auf keinen Fall«, versicherte Doktor Wegener, der sie betreute, seit dem sie erwacht war. »Wir sind lediglich besorgt, weil du während der Zeit deines Komas, die Muskeln nicht belasten konntest. Tu ein paar Schritte.« Er fasste sie, für den Fall aller Fälle, leicht am Oberarm.
Jana ging zum Fenster und zurück. Die Bewegung bereitete keine Probleme.
Das Mädchen war körperlich gesund und, viel wichtiger, das Gehirn funktionierte einwandfrei ohne Ausfälle. Doch Jana sprach nicht. Die medizinischen Geräte und Untersuchungen sowie psychologische Gutachten lieferten keine plausible Erklärung, für den Verlust ihrer Sprechfähigkeit. Mit dem Trost, das gebe sich mit der Zeit, mussten ihre Eltern leben. Für Jana selbst bedeutete das keinerlei Problem, schließlich war es ihr Geheimnis.
*
Kapitel 3 Kriminalpolizei /Jana
»Guten Tag. Ich bin Claudia Plum, Hauptkommissarin der Aachener Kripo.« Claudia betrat forsch das Krankenzimmer und sah auf das hagere Mädchen im Bett. »Du bist Jana Winter«, stellte sie fest. Das Zimmer sah aus wie alle Krankenzimmer in einem Krankenhaus. Platz für zwei Betten, wo zurzeit nur das eine stand, und über dem Kopfende die Versorgungsleiste für Sauerstoff und die Anschlüsse für medizintechnische Geräte. Auf dem Beistellschrank mit dem ausklappbaren Tablett lagen Süßigkeiten sowie ein Notebook und ein I-Pad. An der dem Bett gegenüberliegenden Wand lief eine Kochshow im Fernseher, der, in zwei Meter Höhe, in einer Halterung hing. Ansonsten noch drei grässlich gelbe Stühle, die unbequem aussahen.
Jana nickte.
»Du kannst nicht sprechen«, fuhr Claudia vorsichtig fort. »Ich habe mit deinen Eltern gesprochen.«
Jana nickte wieder und griff zur Tafel, die auf der Konsole neben dem Bett lag.
»Hast du eine Erinnerung, wie es zu deinem Unfall kam?«, fragte Claudia und registrierte die nächste Verneinung. Sie sondierte die Lage. Das Mädchen wirkte weder krank noch verzweifelt. Jana schien keine Probleme mit dem Verlust, ihrer Sprechfähigkeit zu haben. Sie gefiel der Hauptkommissarin und war ihr sofort sympathisch. Die junge Frau, das war sie ja schließlich mit achtzehn Jahren, strahlte ungemein positive Signale aus. Doch Claudias Gefühl spürte etwas im Hintergrund der Gedanken des Mädchens, wo es sich lohnte nachzuhaken. Sie fiel mit der Tür ins Haus und sparte das Herantasten und die Floskeln aus. »Du hattest keine gravierenden körperlichen Verletzungen und dennoch lagst du ungefähr zwei Jahre im Koma. Wenn da irgendetwas war, möchte ich es wissen. Schließlich hatte es drei Tote gegeben und außer dir noch einen jungen Mann, der ins Koma fiel.« Claudia fasste sich innerlich an den Kopf. Sie fiel nicht mit der Tür ins Haus, sondern trampelte, wie ein Elefant im Porzellanladen. Ihr fehlte die Erfahrung im Umgang mit jungen Leuten. Sie revidierte ihre Gedanken: Sie hatte verlernt, mit Menschen umzugehen, die normal waren. Der Beruf forderte seinen Tribut.
Читать дальше