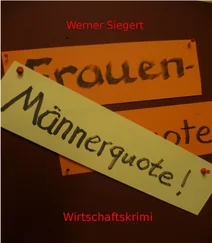Ich las. Die Frau hielt ihr Mini-Köfferchen in der Hand. Ich las - und konnte mir dennoch nicht ein paar mal verkneifen, meine Nachbarin von der Seite anzuschauen. Sie schaute starr in den Waggon. Ein blitzsauberes Mädchen, dachte ich. Sie wirkte tatsächlich sehr mädchenhaft, sehr brav, sehr in sich ruhend. Kein Lächeln. Kein Zucken. Nur das Ruckeln der Bahn. Und ich las. Wie immer in der S-Bahn; da habe ich Ruhe dazu und nutze die Zeit.
An meiner Haltestelle stieg ich aus. Es war sehr kalt draußen. Frost. Morgens 17 Grad minus. Also hatte ich schon vorher die Handschuhe übergestreift und eine Pelzmütze aufgesetzt.
Da stand auf einmal meine Nachbarin auch auf. In ihrem dünnen, weißen Mäntelchen, ohne Mütze. Ohne Handschuhe. Nur krampfhaft ihr kleines Täschchen haltend. Ehrlich gesagt: Sie tat mir leid.
Hinter mir trapste sie die Stufen hinunter. Ich wunderte mich. Ich hatte sie noch nie hier gesehen. Vielleicht wollte sie zu einem Vorstellungsgespräch bei einer Firma hier am Ort, dachte ich. Dafür hat sie das Beste aus dem Schrank geholt, was sie eben hatte.
Ich lief ziemlich schnellen Schrittes mit dampfendem Atem durch die beißende Winterluft. Die Frau? Ich wollte mich absichtlich nicht umsehen. Sonst hätte sie denken können, ich wollte etwas von ihr. An einer Kreuzung musste ich anhalten, um ein Auto vorbei zu lassen. Da stand sie dann wieder neben mir. Jetzt lächelte sie ein ganz klein wenig. Dann setzten wir unseren Weg fort. Offenbar ging sie nicht zu der Firma. Vielleicht zur Pfarrei? Oder zum Kindergarten? Oder zur Grundschule?
Nein, sie folgte mir - und dann, kurz bevor ich unsere Gartenpforte erreicht hatte, fragte sie mich, ob sie wohl mit reinkommen dürfe. Nur vor die Haustür. Ob ich vielleicht eine Scheibe Brot und ein Glas Wasser für sie habe. Ich war, nein nicht vom Donner, sondern vom Entsetzen gerührt.
„Ja natürlich ... kommen Sie nur mit rein. Ich muss das nur meiner Frau erklären. Dass ich eine junge, hübsche Frau mit nach Hause bringe!“
Sie lächelte nur sehr verzagt. Und zitterte. Nicht nur vor Kälte oder auch.
Als wir die Haustür öffneten, stand meine Frau schon dahinter, und ehe ich etwas sagen konnte, machte das Mädchen einen Knicks und bat um Verzeihung.
„Es tut mir sehr leid. Ich heiße Kyra. Ich bin obdachlos. Ob Sie wohl eine Scheibe Brot für mich haben und ein Glas Wasser?“
Meine Frau hielt vor lauter Erschütterung beide Hände vors Gesicht und vergaß ganz, mich zu begrüßen. „Aber natürlich!“ beeilte sie sich zu sagen. Dann, nachdem sie sich gefasst hatte: „Sie können auch mit uns zu Mittag essen!“
Kyra knickste noch einmal, sehr verlegen, sehr scheu, zitternd. Blieb in der Eingangstür stehen.
Ich drängte sie mit vorsichtig tastenden Händen hinein und wollte ihr aus dem Mäntelchen helfen; aber sie wehrte es. Sie wolle es lieber anbehalten. Sie wolle uns ja nicht länger belästigen. „Nur eine Scheibe Brot und ein Glas Wasser!“
„Aber das geht doch nicht. Wenn Sie Hunger haben, wenn Ihnen kalt ist. Wohin wollen Sie denn?“
„Ich weiß es nicht. Ich habe mich in der S-Bahn ein wenig aufgewärmt. Dann sah ich Ihren Mann. Es tut mir leid, dass ich Sie belästige.“
Kyra sprach das ganz reine, das überaus korrekte und fast zärtliche Deutsch einer Frau aus dem Osten. „Kyra“ klingt russisch, aber zugleich musste ich schmunzeln; denn ich dachte an Kyra Kyralina aus einer makabren Geschichte von Gregor von Rezzori, und ein Zitat daraus: „Sie hatte grüne Augen, einen roten Mund und schwarze Haare - und sie hat fürchterlich geschrien!“ Als man sie vom Schlitten den Wölfen zum Fraß vor warf. Diese Erinnerung bemühte ich mich, ganz schnell auszulöschen.
Jetzt fasste ich Kyra an ihr weißes Mäntelchen, um es an die Garderobe zu hängen.
„Aber ich bin doch gar nicht gekleidet für Leute wie Sie!“
„Das ist doch egal. Wir sind ganz normale Menschen. Sie können sich noch ein wenig frisch machen und aufwärmen, bis ich gleich das Essen fertig habe, Fräulein Kyra.“
Alsbald bat ich sie, auf dem Sofa Platz zu nehmen. Sie schaute sich kaum um, blickte einfach nur auf den Boden. „Es ist mir peinlich. Nur eine Scheibe Brot ....“
Dann saß sie mit uns am Tisch, nahm nur ganz bescheiden von allem nur ein winziges Bisschen.
„Greifen Sie doch zu, es ist genug da, und Sie dürfen auch gern länger bleiben. Bei der Kälte. Obdachlos? sagten Sie?“
„Ich darf nicht viel essen. Viel essen - viel Hunger! Der Magen will dann immer mehr. Aber ich weiß nicht, was es morgen gibt. Vielleicht gar nichts.“
„Ja, um des Himmels Willen, wo kommen Sie denn her? Obdachlos - das gibt es doch bei uns gar nicht!“
„Ich komme aus Polen. Ich bin Krankenschwester. Viele Krankenschwestern sind nach Deutschland gekommen. Wollten alte Menschen pflegen. Haben spezielle Ausbildung bekommen und Deutsch-Kurse. Aber nun ist verboten. Keine Arbeitsgenehmigung, Polizei. Kein Geld. Keine Wohnung. Ich habe nicht geglaubt. Aber ist so. Jetzt suche ich Arbeit. Andere Arbeit. Aber es gibt keine Arbeit. Es gibt Männer, die mich mitnehmen wollen, wenn Sie wissen. Habe nur Vertrauen zu altem Mann oder alter Frau.“
„Und wo haben Sie Ihre Sachen?“
„Bei einer Freundin. Die hat noch Arbeit im Krankenhaus, mit Genehmigung. Aber nur ein ganz kleines Zimmer. In einem Schwesternbau. Dürfen keine Fremden mitbringen. Ist sehr streng. Weil viele Polinnen gekommen sind. Viele arbeitslos und schlafen in S-Bahn oder irgendwo.“
Kyra wollte gleich wieder weg. Aber meine Frau hielt sie an einer Hand fest.
„Ich muss noch Flaschen sammeln. Leere Flaschen. Für das Pfand, damit ich S-Bahn-Fahrkarte zahlen kann.“
„Vielleicht können Sie meiner Frau helfen. Es gibt immer was zu tun. Dann brauchen Sie nicht Flaschen zu sammeln. Bekommen Geld.“
„Ja, ich kann puutzen; aber muss nicht sein. Sind so gut.“
Kyra blieb. Sie half. Es gibt immer was zu tun. JETZT.
Wir konnten uns ehrlich gesagt kein MORGEN für Sie vorstellen.
Wie wirkt das JETZT, wenn es kein MORGEN gibt?
Als ich das am nächsten Morgen im Büro erzählte, meinten die meisten: „Die wollte bestimmt nur Euer Haus ausspionieren.“☺
Sie ließ mir keine Melodie
Es gibt Tage, da ist der Regen kälter und durchdringender für mich als für alle anderen. Die Häuserfronten, an denen ich entlang flüchte, sind grauer, abgeblätterter, hässlicher als sonst. Die Autos sind lauter, rücksichtsloser - und sie spritzen ihren Gischt mehr gegen mich als gegen andere. Das Telefon läutet schriller, und alle Nachrichten, die es mir zu schreit, sind schlimmer für mich als an allen anderen Tagen.
Ich fliehe diese Tage, die mich töten wollen wie ein Schwarzer Vogel, der die Beute schlägt. Sie sind so tückisch, weil sie lautlos daherschweben, ohne Warnung, ohne ein Sausen in der Luft, ohne ein Omen, das mir signalisieren könnte: Dies ist kein Tag für dich.
An solchen Tagen wird mein Leben kürzer, ohne dass ich es erleben darf. Depressionen schleichen sich heran. Sie springen mir aus dem Spiegel entgegen, in den ich morgens schlaftrunken blicke und Bestätigung dafür suche, dass es mich noch gibt. Wenn die Züge dessen, der mich aus dem beschlagenen Silberglas verschreckt, ohne Freude sind, wenn die Brauen schwer über müden Augen liegen, weil schon die Nacht nicht Ruhe spenden mochte, dann haftet sich die Fratze an mich und lässt mich straucheln fast bei jedem Schritt.
Natürlich weiß ich längst, dass all dies Unsinn ist. Mein Kopf weiß es. Die andere Instanz. Ich weiß, der Arzt könnte mit einem unleserlichen Federstrich Mittel verordnen, die den Grauschleier wegschwemmen und meinem Grimm keine Chance mehr lassen. Weil die Chemikalien es so wollen, muss ich dann heiter werden. Oder wenigstens normal - so wie die anderen Leute einfach nur nass werden, wie jeder halt, der durch Regen läuft. Wie andere das Donnern eines leeren Camions nur grässlich laut empfinden, aber nicht als tödlich für eine hochsensible, fragile Seele. Ich kann auch wohlfeilen Rezepten folgen. Mir autogenes Training verordnen, meine Nerven überlisten und kommandieren, sie mögen meine Hände warm durchfließen, da sie frieren.
Читать дальше