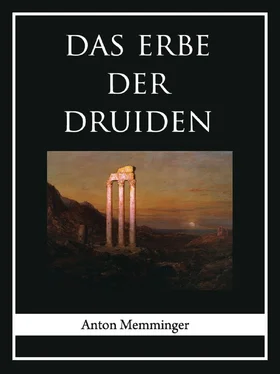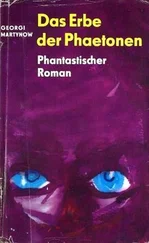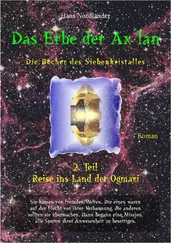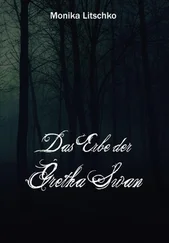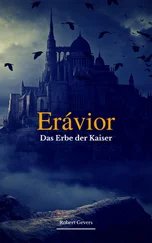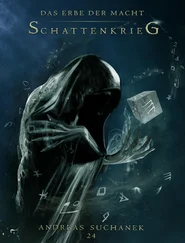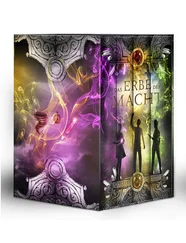Das Erbe der Alten umfasst aber, was selbst den wenigsten Gebildeten bekannt ist, noch mehr als die Überreste des lateinischen und griechischen Sprachschatzes. Denn vor den Römern und vor den Deutschen saß in unseren Gauen das Volk der Kelten , das zahlreiche Spuren seiner Kultur in unserem Lande und in unserer Sprache, insbesondere in der Mundart unseres Frankenlandes hinterlassen hat. Ich nenne es das Erbe der Druiden , weil dieser Stand vermöge seiner Bildung, Organisation und Tätigkeit der hervorragende Träger der nationalen Kultur war. Von dem Dasein der Kelten und ihrer Einwirkung auf die deutschen Nachbarn und nachherigen Herren zeugt noch heute die Menge der keltischen Fluss-, Flur-, Orts- und Personennamen, die sich im ehemaligen Ostfranken, wie die fränkischen Könige das von ihnen eroberte Maingebiet einschließlich Thüringen benannten, erhalten hat. Aus der Menge der Personennamen , die ich bei meinen Forschungen zur Herausgabe meines Werkes „Schloss Mainberg“ in Urkunden, Akten und allerhand Schriften gefunden, habe ich ein Verzeichnis angelegt und mit entsprechenden Bemerkungen versehen. Diese keltischen Sprachreste sind ein Beweis, dass die Deutschen für viele Dinge, Berufe und Hantierungen keine eigenen Namen hatten und darum die Bezeichnungen des kulturell höher stehenden Volkes in ihre Sprache übernahmen. Anderseits wurden auch Worte und Namen deutscher oder anderer Abstammung keltisiert, so dass ihre Herkunft oft schwer zu bestimmen ist. Mit Recht sprechen darum unsere Geschichtsschreiber von einer keltisch-thüringischen Periode. Selbst die im siebenten Jahrhundert einsetzende Eroberung des Landes durch die Franken änderte daran nicht viel, nur traten zu den keltischen noch die lateinischen Lehnworte, die die neuen Eroberer mit den Errungenschaften der römischen Kultur aus Frankreich mitgebracht hatten. Obschon sie auf ihre deutsche Rasse und Sprache etwas hielten — sie gaben ihren Ansiedlungen wie ihren Zwingburgen nur deutsche Namen — so erhielt sich trotzdem der alte Dialekt mit dem keltischen Einschlag bei der Masse des unterworfenen Landvolkes, was aber von den Sprachforschern viel zu wenig oder gar nicht beachtet wurde.
Der keltische Einschlag zeigt sich aber noch in anderen völkischen Eigentümlichkeiten. Gerade in Franken lassen die Merkmale des Typus, der Kopf- und Körperbildung, der Haar- und Hautfarbe, der Aussprache und Tongebung, dann die Äußerungen des Temperaments und Charakters, Einrichtungen und Gewohnheiten der Wirtschaftsführung, auch gewisse geistige Anlagen und Richtungen, Lebensart, Sitten, Gebräuche, Trachten und Mundarten die keltischen Spuren erkennen. Es ist zum Beispiel ein großer Unterschied zwischen den Gestalten und Gesichtern der weiblichen Bevölkerung rings um Bamberg und jener in unserer Gegend. Dort erkennt man an den drallen Körperformen, den schwarzen Stichelhaaren, den breiten Stirnen, den hervorstehenden Backenknochen und gelblichen Gesichtern die Abstammung von der slavisch-wendischen Bevölkerung, deren Verdeutschung erst im zwölften Jahrhundert begonnen hat. Noch im fünfzehnten Jahrhundert wurde in der Bamberger Gegend wendisch gepredigt. Die Verdeutschung der keltischen Bevölkerung liegt um Jahrhunderte hinter jener der wendischen zurück. Aber die Merkmale der älteren Kulturrasse sprechen noch heute aus den meist schlanken Gestalten, den kleinen Füßen, den länglichen, fein geschnittenen irischen Gesichtern, den dunklen, schelmischen Augen der Dorfschönen mit ihrer Vorliebe für farbige Kleider, dem glänzenden Schmuck und den eleganten frei getragenen Haarfrisuren, während die Frauen wendischer Abkunft ihre Haarbüschel unter einem großen Kopftuch verbergen. Wer viel unter fremden Völkern gereist und sich aufgehalten hat, dem ist sicher die Ähnlichkeit vieler von unseren fränkischen Bauernmädchen mit jenen in der Bretagne, Wales und Irland aufgefallen.
Bezeichnend für Charakter, Beruf und Kultur der im Frankenland angesiedelten Völkerschaften ist, dass die meisten Namen keltischer Abkunft, die nach der Angabe des gelehrten Augustinerpaters Alfons Abert in seiner von den kirchlichen Oberen verpönten Schrift „Franken“ auf bert, fert, gert, ert, bret, fred und fried endigen, von einer landwirtschaftlichen oder gewerblichen Beschäftigung abgeleitet wurden, während die auf ward, wart, hart, art, halt, bald, hold, polt endigenden fränkischen Namen eine militärische oder amtliche Tätigkeit bezeichnen. In diesem Unterschied drückt sich der Charakter der fränkischen Eroberer; die ein unterjochtes Volk beherrschten, zur Genüge aus. Auch belehrt uns die Forschung, dass Namen keltischer Herkunft auf ert, bert usw. vor dem Jahre 1400 höchst selten in den Städten, die nur von fränkischen Ansiedlern bewohnt wurden und auf die Reinheit ihrer Rasse hielten, auftauchen. Erst nach dem fränkischen Städtekrieg 1400, in dem der gewalttätige Würzburger Fürstbischof Gerhard von Schwarzburg mit dem reinrassigen fränkischen Bürgertum aufräumte, sehen wir die Träger keltischer Namen in den Städten in größerer Zahl auftauchen. Manche dieser Namen sind ganz verschwunden, da deren Träger ausgestorben sind oder deutsche und christliche Namen sich beigelegt oder nach der Sitte des Reformationszeitalters ihre Namen latinisiert oder gräzisiert haben. Eine größere Anzahl der keltischen Personennamen hat auch durch Weglassung des Schlussbuchstabens oder der ganzen Endsilbe oder durch Austausch mit einer fränkischen Endung (art, bold usw.) die Spuren ihrer Herkunft und ihres aufgezwungenen Untertanenverhältnisses verwischt. So wurde aus Eckert ein Eck, aus Blümert Blüm oder Blum, aus Gressert Kreß, aus Höpfert Hopf oder Höpflinger, aus Schackert Schack, aus Humbert Humbold, aus Rossert Rossat oder Rosa, aus Bullert Bull oder Buhl, aus Herbert Herbart, aus Burkert Burkard oder Burk, aus Hebert Heberer, aus Possert Possart, aus Bollert Boll, aus Schuckert Schuck, aus Buchert Buch, aus Marken Mark oder Merk, aus Beckert Beck, aus Baggert Back, aus Engert Engel, aus Trabert Trapp, aus Bronsert Bronsart, aus Billert Bill, aus Kippert Kipp, aus Klaibert Klebert, aus Ruckert Ruck und Rock, aus Dippert Dippold, aus Rauschert Rauscher, aus Roschert Roscher, aus Dennert Dennerlein, aus Tannert Tanner und Tannera, aus Seibert Seifried, aus Krackert Krakhard, aus Weckert Weck, aus Wigert Weigert, aus Tellert Tell oder Till, aus Gäbert Gäb usw.
Die Namensbildung ist noch viel mannigfaltiger, als uns in den gelehrten Werken von Kleinpaul, Bähnisch, Leier u. a. vorgetragen wird. Mit dem Aufschwung der mittelalterlichen Städte, die Zuzug fremder Handwerker erhielten, wurden viele Leute lediglich nach dem Heimatlande benannt, von wo sie herstammten. Da treffen wir die Sachs, Schwab, Baier, Heß, Brandenburger, Rhein und Rheinisch, Böhm, Österreicher, Unger, Ruß, Welsch und Welscher, Schweizer, Elsässer, Holländer u. a. Ihre ursprünglichen Familiennamen wurden in der neuen Heimat durch ihre Herkunft ersetzt. So berichtet der berühmte Nürnberger Künstler Albrecht Dürer in seiner 1524 niedergeschriebenen Familienchronik, dass sein Großvater in Ungarn beheimatet war, sein Vater nach Nürnberg auswanderte, während dessen Bruder Niklas Dürer als Goldschmied in Köln sich niederließ und dort den Namen Unger annahm. Noch häufiger wurde der Personenname nach dem Heimatsort gebildet. Es gibt deren nach Hunderten, bei uns in Bayern namentlich solche auf ing und inger. Der Name Mainberger findet sich schon vor Jahrhunderten in Nürnberg. Die nach Ortsnamen gebildeten Judennamen stammen erst aus dem 18. Jahrhundert, als die Israeliten aus polizeilichen Gründen gezwungen wurden, deutsche Namen zu wählen. Sie wählten aber nicht nur wirkliche Ortsnamen, sondern auch erdichtete wie Goldstein, Veilchenstein, Nordschild, Silberstein, bei denen es wohl vergeblich wäre, eine Karte zu Rat zu ziehen. Als nach dem Aufblühen der deutschen Städte die bürgerlichen Berufe und Handwerke in Aufschwung und Ansehen kamen, wurde auch die ständische Beschäftigung wieder zum wichtigen Unterscheidungsmerkmal. Anstelle der Bezeichnungen keltischer Herkunft traten jetzt die deutschen: Ackermann, Baumann, Futterer, Meder (Mähr), Fischer, Bader, Bäcker, Brauer, Schneider, Schuster, Zimmerer, Küfer, Binder oder Büttner, Maurer, Glaser, Müller, Schreiner, Wagner, Hafner, Schmied, Amtmann, Kannengießer, Keller (Verwalter der Zehentböden und Weinkeller), Freibot (Kuppler), Hauptmann, Kammerer (Kassenverwalter), Richter, Schreiber usw. Auch altdeutsche Namen fanden sich, vor allem sämtliche fränkische Namen, die im Nibelungenlied vorkommen und auch in fränkischen Ortsnamen sich finden. Daneben gab es Namen, die mit dem Christentum zu uns kamen, so z. B. Adami oder Adel, Endres (Andreas), Donle (Anton). Bartelme (Bartholomäus), Christl (Christof), Dietz (Dietrich), Feh oder Feyh (Sophie), Balzer (Balthasar), Simmerl (Simon), Jäckle (Jakob), Hans (Johann), Heiner und Heinz (Heinrich), Steffel (Stefan), Jörg (Georg), Leisel und Leyß (Elisabeth), Mars (Markus), Karches (Eucharus), Lenz (Lorenz), Jobst (Jodokus), Mathes (Mathäus), Melcher (Melchior), Klaus (Nikolaus), Ambros (Ambrosius), Rudi (Rudolf), Veit und Veitl (Vitus), Basil (Sebastian), Wenz (Wendelin), Hardl (Leonhard). Es gibt bei uns sogar Bauern deutscher Abstammung und Rasse, die Kohn heißen. Der Name ist aber nicht gleichbedeutend mit dem hebräischen Namen Cohen, Kochem, Kahn oder Kohn, sondern ist die Abkürzung für Konrad, wie Fritz für Friedrich, Sepp für Joseph, Mart oder Mert für Martin.
Читать дальше